74 Jahre waren Rudolf Hindemith auf dieser Erde vergönnt, von denen die Musik nahezu 70 Jahre bestimmt hat. Geboren wurde er am 9. Januar 1900 in Niederrodenbach (bei Frankfurt a. M., Deutsches Kaiserreich), am 7. Oktober 1974 verstarb er in München.

Rudolf Hindemith im Alter von 30 Jahren. Foto: Archiv DTKV
Cellist, Dirigent, Komponist, Lehrer
Als Kind vom Vater zum Cello geführt, wurde aus ihm bereits früh ein meisterhafter Spieler. Als Frankfurter Kindertrio trat er mit Bruder Paul und Schwester Antonie unter väterlicher Aufsicht öffentlich auf und „strich“ dort schon als knapp Sechsjähriger „wacker seinen Baß“, wie Presse und Publikum beeindruckt feststellten. Mit zehn Jahren besuchte er bereits das renommierte Hoch’sche Konservatorium in Frankfurt und verließ es als „fertiger“ Cellist und Dirigent im März 1919. Unmittelbar nach seinen Examina begann für Rudolf Hindemith eine glänzende Karriere als Cellist.
1920: Erster Solocellist beim Münchener Konzertverein; 1921: Erster Solocellist im Orchester der Wiener Staatsoper. Parallel dazu erfolgreicher Kammermusiker mit dem sogenannten H-Trio mit Anton Huber (Violine) und Valentin Härtel (Viola). Ab 1924 ging er als festes Mitglied für drei Jahre mit dem von seinem Bruder Paul und dem Violinisten Licco Amar gegründeten Amar-Quartett auf zahlreiche, sehr erfolgreiche Konzertreisen.
Unruhiger Geist
Als unruhiger Geist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen elektrisierte ihn der Mitte der 20er Jahre nach Europa gekommene Jazz. Rudolf verließ das Amar-Quartett, gründete eine eigene Jazz-Band, schrieb für sie zahlreiche Bearbeitungen bekannter Jazz-Stücke und trat mit ihr in den Jahren 1926/27 als erste „Rundfunk-Jazzband“ des Frankfurter Radiosenders auf. Dabei spielte Hindemith nicht etwa Cello, sondern Saxophon! Seine Fähigkeiten als Dirigent konnte er bislang nur vereinzelt unter Beweis stellen. Das änderte sich, als der Berliner Rundfunk ihn 1930 als Dirigent seines Funkchores und des Funkorchesters engagierte. Hier stießen vor allem seine Interpretationen einer Reihe von Zyklen aus Verdi-Opern auf ein ungeteilt positives Echo beim Publikum und der Fachwelt.
Zeitgleich zu seinem Engagement in Berlin baute er sich von 1931 an mit seinen Münchener Bläsern ein weiteres Standbein als Dirigent in Bayern auf und war damit auf dem besten Wege, eine glanzvolle Karriere als Orchesterleiter einzuschlagen.
Durch die intensive Arbeit mit der Bläservereinigung verlagerte er den Schwerpunkt seines Schaffens nach München und beendete seine Dirigententätigkeit in Berlin. Er begann nun auch als Komponist hervorzutreten. Seine ersten Werke konnte er im Rahmen einer Konzertreihe aufführen, die er in München etabliert hatte. Der Pianist Hermann Bischler, mit dem er über Jahrzehnte freundschaftlich verbunden war, stand als Interpret zahlreicher Werke zur Verfügung. Schon bald dachte er als Komponist an größere Herausforderungen. In den Jahren 1938/39 komponierte er seine erste Oper „Konradin der letzte Hohenstaufe“. Diese wurde allerdings nie vollständig aufgeführt, vielmehr blieb es bei der konzertanten Präsentation von einzelnen Stücken aus diesem Werk.
Dass Rudolf Hindemith in diesen Jahren zunehmend als Dirigent und Komponist von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, führte zu einem Disput mit seinem Bruder um den Namen „Hindemith“. Den hatte der international bekannte Komponist Paul Hindemith bislang für sich gepachtet, wie es dem jüngeren Bruder Rudolf schien. In der Folge bediente sich Rudolf deshalb verschiedener Pseudonyme, bis er sich Anfang der 50er Jahre endgültig auf den Namen „Hans Lofer“ festlegte.
Am 14. Dezember 1939 heiratete er die Pianistin und Klavierpädagogin Maria Landes (1901–1987), mit der er durch seine musikalische Arbeit bekannt war und die bereits eine Reihe seiner Werke aufgeführt hatte.
Noch unter dem Namen „Rudolf Hindemith“ komponierte er zu Beginn der 40er Jahre eine Reihe von „Militärmärschen“ für Luftwaffen-Orchester, die man als eine absolut eigenwillige und ungewöhnliche, hochkarätige musikalisch-künstlerische Auseinandersetzung mit dieser Thematik bezeichnen kann.
Von 1942 bis 1944 trat er als Dirigent der Philharmonie des Generalgouvernements in Krakau überaus erfolgreich in Erscheinung. Anschließend kehrte er nach München zurück, führte aber seine Tätigkeit als Dirigent nicht weiter fort. Stattdessen widmete er sich in den Nachkriegsjahren seinem Schaffen als Komponist und als Lehrer zahlreicher Schüler, die er oftmals im Zusammenwirken mit seiner Frau unterrichtete, die inzwischen als Professorin an der Münchner Musikhochschule tätig war.
Zahlreiche renommierte Musiker sind aus dieser „Unterrichtseinheit“ hervorgegangen. In heutiger Zeit sind es unter anderem zwei „Enkelschüler“, die internationale Wertschätzung finden: in Deutschland der vielfach ausgezeichnete Musiker, Hochschulpädagoge und Jazz-Pianist Michael Wollny, dessen langjährige Lehrerin Jutta Müller-Vornehm bei Rudolf Hindemith und Maria Landes Unterricht hatte, und in Österreich die Konzertpianistin und Hochschulpädagogin Stephanie Timoschek-Gumpinger, die bei Prof. Annamaria Bodoky-Krause, ebenfalls eine Schülerin von Rudolf Hindemith und Maria Landes, studierte.
Das sehr vielseitige Œuvre von Rudolf Hindemith als Komponist umfasst neben zahlreichen Werken für Klavier, kammermusikalische Besetzungen und Orchester auch eine weitere Oper: Des Kaisers neue Kleider. Diese erschien im Brucknerverlag (heute: Bärenreiter Verlag) und wurde im Jahre 1951 in Gelsenkirchen uraufgeführt. Bis in die heutige Zeit konnte sich diese als erfolgreiches Bühnenstück behaupten.
Das Gesamtwerk von Rudolf Hindemith erscheint seit dem Jahr 2000 im Verlag Karthause-Schmülling (www.karthause-schmuelling.de). Dort wird auch in Kürze eine mit zirka 500 Seiten ausgesprochen detaillierte Monographie über den Komponisten veröffentlicht werden, eine erste größere Aufarbeitung dieses Komponisten. An den biografischen Teil des Buches schließen sich umfangreiche Verzeichnisse mit dokumentarischem Material an: Zeitungsberichte, Konzertveranstaltungen, Musikprogramme und Werkeverzeichnis.
Während Rudolf Hindemith tatsächlich noch auf seinem Grabstein mit dem Namen „Hans Lofer“ genannt werden wollte, bedarf sein schöpferisches Werk heute keines Pseudonyms mehr. Es lebt und passt vielleicht mehr denn je in die Zeit!
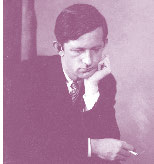
Hans Gerd Brill, Rudolf Hindemith – Zwei Leben. Kurzbiographie und Werkverzeichnis.
Bücher und Noten Karthause-Schmülling:
https://karthause-schmuelling.de/author/hindemith-rudolf/
Hans Gerd Brill, Rudolf Hindemith – Zwei Leben. Kurzbiographie und Werkverzeichnis. Karthause-Schmülling Verlag, Kamen, 2000. – ISBN 978-3-922100-10-2
Vorschau: Hans Gerd Brill, Rudolf Hindemith. Cellist, Dirigent, Komponist, Lehrer
ISBN 978-3-922100-27-0 · ca. 500 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Fotos
Erscheint im 2. Halbjahr 2025 im
Karthause-Schmülling Verlag, Kamen
- Share by mail
Share on