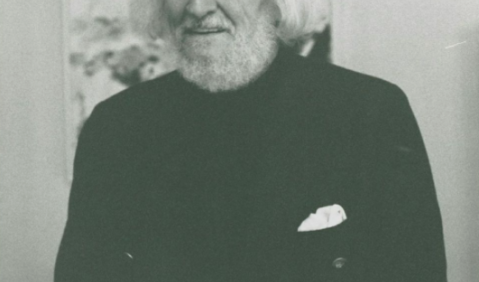Zwei Landpartien. Die aktuelle führt zum Carinthischen Sommer. Das Kärntener Festival orderte in den 1970er Jahren beim damals erfolgreichen österreichischen Opernkomponist ein neues Stück. Gottfried von Einem hatte 1947 die Büchner-Oper „Dantons Tod“ zu den nach den Jahren der NS-Kontaminierung wiedereröffneten Salzburger Festspielen beigesteuert und 1953 am selben Ort den „Prozeß“ (nach Kafka). 1971 beglückte er die Wiener Staatsoper mit dem „Besuch der alten Dame“ und schloss, gestützt auf Friedrich Dürrenmatts Libretto, zur politisch-gesellschaftlichen Gegenwart auf. Im Ossiacher Stiftshof sollte dann vor vier Jahrzehnten „Jesu Hochzeit“ herauskommen – aus gegebenen Umständen eine Kirchenoper.
Der Text stammte von Lotte Ingrisch, die Frau des Komponisten, und war erfüllt von nachdenklicher Kommentierung theologischer Schlüsselfragen und frischer Liebe. Einschlägig vorbelastete katholische Kreise Österreich, angestiftet von einer auf „Blasphemie“ erkennenden Geistlichkeit, verhinderten die Uraufführung der ‚Mysterienoper‘ am vorgesehenen Ort. Eine Protestbrief-Lawine suchte auch die Realisierung im Rahmen der Wiener Festwochen und die Ausstrahlung im ORF zu Fall zu bringen. Schließlich erhob sich im Theater an der Wien eine veritable Randale – das alles, ohne dass sich die von einem Polizeiriesenaufgebot in Schach gehaltenen Protestierenden die Mühe gemacht hätten, von dem, wogegen sie eiferten, Kenntnis zu nehmen. Den selbstberufenen Gottesstreitern genügte der in ihren Ohren aufreizende Titel.
Ingrisch hatte Szenen zum Leben des Religionsgründers aus Nazareth arrangiert, indem sie Zitate aus dem Neuen Testament mit den von Jesus ausgehenden mittelalterlichen Liebes- und Todesvorstellungen verschränkte. Als anrüchig empfunden wurde, dass Judas im II. Akt einen Altar mit den Insignien der Kirche schmückt und dass die Büßerin Maria Magdalena auch Verführerin ist (aber als was denn sonst, bittesehr, charakterisieren sie die einschlägigen Passagen der Evangelien?). Die Verse und Sentenzen der Librettistin griffen insbesondere auch die aus Salomons Hohem Lied, der Apokalypse des Johannes und einer Weihnachtspredigt des Heiligen Augustinus herrührende Denkfigur des göttlichen Bräutigams auf. An diesem Bild gewordenen Sponsus-Motiv nimmt zwar beim Besuch des Magdeburger Doms oder beim Hören Bachscher Kantatentexte niemand Anstand. Bei Ingrisch freilich diente diese Art der frommen Liebeserklärung 1980 noch dazu, ihre Verbrennung als „Hexe“ zu fordern. Sie hat überlebt und streitet weiter wacker für die Oper (mit der auch ihre Liebe überlebt).
Der Theologe und Analytiker Arnold Mettnitzer sekundiert ihr dabei. Er tat es hintergründig und poetisch angereichert bereits im Mai in Wien bei einer Konferenz der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und jetzt neuerlich im Rittersaal des Ossiacher Stifts. Mettnitzer richtet den Blick auf den Liebesbegriff des Alten Testaments, nimmt Bezug auf Darstellungen von Bernini („Verzückung der Heiligen Theresa“) und Michelangelo, ordnet von Einems Oper in eine Serie von Kunstwerken zum Leben Jesu im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ein – von Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“ (1971) bis zu Martin Scorseses „Letzte Versuchung“, dem 1988 in die Kinos gekommenen Film nach dem Roman von Nikos Kazantzakis. Und er spannt den Bogen zu einer „Theologie der Zärtlichkeit“, die in dieser Form bislang nicht offizielle Kirchenlehre war (diese herauszufordern, zu reformieren und ergänzen trachtet, nicht aber bekämpft). ‚Friendly fire‘ also.
36 Jahre nach dem mühsamen Triumph der Kunstfreiheit im Theater an der linken Wienzeile rückte „Jesu Hochzeit“ nun zwar nicht in die Kirche ein (das soll und mag noch kommen), wurde aber im Stiftshof präsentiert. In leicht auffälliger Alltagskleidung versammelte die Regisseurin Nicola Raab die singenden Akteure zu einer Dramaturgie-Sitzung an einem langen Tisch im knirschenden Kies (ihm wurde aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften „Ehrlichkeit“ zugesprochen, was er sicher gerne hört). Jesus & Co. machen sich, wie in den Romanen von Kazantzakis, mit den ihnen zugedachten Rollen vertraut, versichern sich dieses „als ob“ und stellen so zunächst Distanzen her zu den Texten und Botschaften, die sie dann mit sich steigernder Emphase überwinden. Auf denkwürdige Weise nimmt die Versuchsanordnung durch diese Verfahrensweise Züge protestantischer Nüchternheit an: zentriert auf das rezitierte, skandierte, chorisch gestanzte und nur selten lyrisch ausgesungene Wort. Die produktive Distanzierung von szenischen Vorgaben erscheint am stärksten bei der Zelebration der „chymischen Hochzeit“ der Tödin mit Jesus – da kommt der Gesang vom Band. Im Übrigen aber kann Ursula Hesse von den Steinen den ewigen Auftrag des nach romanischer Konvention weiblichen Todes mit trotzigem Blick und funkelnden Augen energisch vortragen. Annette Schönmüller hat am Ende mit Maria Magdalenas sinnlichen Mezzo-Melodiezügen und so tröstlichen Zeilen wie „Gott lässt uns nicht allein“ die besseren Karten im kleinen Gott-und-die-Welt-Theater.
Und Jesus? Der Bariton Boris Grappe leistet Beachtliches in einer Rolle, die – ganz zwangsläufig – die stärksten Darsteller überfordern muss. Denn die Stilmittel von Ironie oder Sarkasmus stehen ernsthaft nicht zu Gebote. In einer „Kirchenoper“ verschränken sich nun einmal positiv (angewandte) Tonkunst und positiv zu verstärkendes religiöses, gläubiges Leben in jener besonderen Weise, für die anderweitig funktionierende Kriterien nicht gelten wollen. Jonathan Stockhammer zupft nicht nur selbst auf der E-Gitarre, sondern administriert energisch und mit Verve einen Tonsatz, der sich in Gänze an der Idiomatik des Opern-Mittelguts aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts orientiert (ihn als Vorboten der Postmoderne zu feiern, wäre wohl eine aus Missverständnis resultierende Volte).
Auch unter den besonderen akustischen Bedingungen open air lässt der – sinnigerweise – aus Los Angeles stammende Dirigent das innige Cello-Solo und andere Streicher-Freundlichkeiten, das Trompetensignal oder das Flöten-Dolce zum vorübergehenden Tod des Lazarus zu sinnlichen und teils hintersinnigen Geltungen kommen. Das mag, beiläufig, die nachhaltigste Wahrnehmung der Ossiacher Wiederaufführung bleiben: Wie sehr Gottfried von Einem die Partitur zu „Jesu Hochzeit“ von Avantgardismen entschlackt hat und bei der Kunst der Väter einkehrte. Auch 1980 stellte diese „Hochzeit Jesu“ keine wirklich kritische Masse dar – und kulturrevolutionär war sie schon gar nicht. Aber Dumpfösterreich entstellte sich mit ihr wieder einmal zur Kenntlichkeit. Grüß Gott!
Eine außergewöhnliche Uraufführung
Bereits Mitte Mai bot sich der Anlass zu einer weiteren Exkursion von Wien nach Südwesten. Nicht anders als Ossiach erscheint Bruck an der Mur als Sommerfrische par excellence. Auch dieses Städtchen in der nördlichen Steiermark ist einer der zahlreichen Fremdenverkehrsorte Österreichs mit spitzem Kirchturm, barockem oder biedermeierlichem Ortskern, sauber-modernen Siedlungsstraßen an der Peripherie und Filialen der gängigen Supermarktketten. Doch Bruck verfügt auch über ein großes und leistungsfähiges Kulturhaus (erbaut 1924–26 als Haus der Arbeiterbildung und -Kultur, 1934 vorübergehend als Gefangenenlager für die Verlierer im Bürgerkrieg genutzt). Nicht zufällig an diesem Ort trafen sich Mitte Mai an die achtzig Chöre, um den 125. Geburtstag des Österreichischen Arbeitersängerbundes (ÖASB) zu feiern und das Motto praktisch unter Beweis zu stellen: „Singen baut Brücken“. Das Sängerfest und die dieses tragende Chorbewegung präsentierten sich in großer Breite und Vielfalt. Beim Eröffnungskonzert fand der Projektchor des ÖASB mit dem Savaria Symphonie Orchester aus Ungarn zu einer Pionierleistung zusammen – zur „Koloman-Wallisch-Kantate“.
Nach dem aus dem Banat stammenden Arbeiterführer ist heute der Hauptplatz von Bruck benannt. Sein Schicksal hat sich mit dem der Region Anfang der 1930er Jahre verwoben: Von hier aus koordinierte er den Abwehrkampf gegen die austrofaschistische Aushebelung der Republik. In der Nähe von Bruck wurde er verraten und gefangen, in Leoben mit einem Würgegalgen ermordet. Bertolt Brecht widmete seinem Kampf und Sterben einen Kantatentext, den Hanns Eisler mit Musik versehen sollte. Hartmut Krones erläuterte die Zeitumstände, deretwegen das Vorhaben erst nach acht Jahrzehnten realisiert wurde: Ein bewusst heterogen gestaltetes und doch zur Einheit in Vielfalt sich fügendes oratorisches Werk.
Zu Passagen von Gunter Waldek, die an traditionelleren Schreibweisen für Laienchöre anknüpfen, setzt sich die kühlere Härte und das Flüstern der von Hannes Heher beigesteuerten Teile ebenso in Kontrast wie die an Mauricio Kagels Modernität geschulte Schreibweise von Julia Purgina. Eine stilistische Mixtur stellt bereits der Text dar. Der Pluralismus schreibt sich in den Beiträgen von Kurt Schwertsik, Gerd Kühr, Roland Freisitzer, Elisabeth Harnik, Wolfram Wagner und Gunter Waldek fort. Sie forderten von den Interpreten ein Äußerstes ihrer Möglichkeiten und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Das ist Bildungsarbeit par excellence.