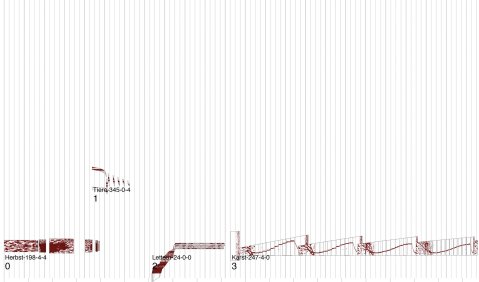Dass die Digitalisierung die Musik verändert, steht außer Frage. Für einen Großteil der Komponist*innen gehört die Arbeit mit digitalen Elementen zum Alltag. Trotzdem (oder gerade deswegen?) kommt von diesen Komponist*innen kaum jemand auf die Idee, die Elektronik mit einem Ensemble oder Orchester zu verwechseln, als Ersatz für eine*n lebendige*n Improvisationspartner*in zu sehen oder das Schreiben von Noten für überflüssig zu erklären.
Harry Lehmann tut jedoch in „Komponieren im Medium der Samples“ (nmz 2/2020) genau das: Er sieht die Elektronik bloß als die „bessere Musikerin“ und wird ihr so überhaupt nicht gerecht. Mit diesem Artikel möchte ich seiner Argumentation in einem grundlegenden Punkt widersprechen: „ePlayer-Orchester“ und reale Orchester lassen sich nicht so miteinander vergleichen, wie er es tut. Von einer „Demokratisierung des Orchesterklangs“ kann daher nicht gesprochen werden.
Für die von ihm ausgemachte „bis in die letzten Winkel der Kunstmusik reichende Transformation“ bezeichnet Lehmann einmal mehr die „Entwicklung von virtuellen Orchestern“ als ausschlaggebend. Ich frage mich, womit er die Vienna Symphonic Library und conTimbre verglichen hat, wenn er keinen Unterschied zwischen einem Samplelibrary-Produkt und der Aufnahme eines realen Orchesters gehört hat. Sicher – die Ergebnisse der „virtuellen Orchester“ haben sich deutlich verbessert – sie sind aber trotzdem weit davon entfernt, nicht mehr als virtuelle Klangerzeugung erkennbar zu sein. Doch selbst wenn wir für einen Moment das Gedankenspiel mitspielen, dass sich in Zukunft die Ergebnisse von Samplelibraries klanglich nicht mehr von Aufnahmen realer Orchestern unterscheiden – Lehmanns Schlussfolgerungen bleiben schlicht Unsinn.
Die „30 ePlayer-Basstrompeten mit Fagottmundstück“, die laut Lehmann in Thomas Hummels „Sinaida Kowalenko“ vorkommen, mögen einen fantastischen Klang erzeugen – ich kann nur beim Hören (und Sehen!) des Stückes weder diese „Instrumente“ noch deren Anzahl erkennen. Eine solche „Instrumentierung“ mag in ihrer Quantität beeindrucken, doch Klangerzeugung auf Grundlage von Samples ist in ihrer Vervielfachung fast unbegrenzt. Genauso gut ließen sich 100 „ePlayer-Basstrompeten“ besetzen, denn Hummel schreibt eben nicht für Sextett und 30 Basstrompeten, sondern für Sextett und Elektronik.
So zu tun, als sei eine „ePlayer-Basstrompete“ nichts anderes als eine Basstrompete, ist reichlich naiv. „ePlayer“ können nicht „viel mehr als Orchestermusiker“, sie können etwas grundsätzlich anderes. Denn was Lehmann völlig außer Acht lässt, ist der performative Unterschied zwischen einem Lautsprecher und einem Orchester. Der Unterschied zweier Medien ist nicht bloß ein klanglicher: Die visuelle Wirkung und historische Konnotation eines Solopianisten unterscheidet sich von denen eines Bratschenduos, eines Barockorchesters oder einer Big Band. Anders gesagt: Mit einem Orchester sitzen auch 250 Jahre klassisch-romantische Orchestertradition auf der Bühne. Ein Lautsprecher vermittelt auf visueller wie historischer Ebene etwas völlig anderes. Theoretisch kann ein Lautsprecher klingen wie ein Orchester, er wird aber niemals eins sein.
Wenn ich Hummels „Sinaida Kowalenko“ anhöre, dann höre ich vieles, doch eins höre ich nie: ein Orchester. Und glücklicherweise auch keine Elektronik, die Orchester sein will. Denn Hummel hat eben genau diesen Fehler nicht gemacht: zu ignorieren, wie eigentlich klingt, was er da schreibt – und vor allem, für welches Medium er schreibt. So bleibt „Sinaida Kowalenko“ eindeutig Kammermusik, in der nicht ein abwesendes Orchester durch elektronische Imitation ersetzt wird, sondern akustische Instrumente und Elektronik sich ergänzen.
Es gibt keinen Grund, Musiker*innen und Elektronik gegeneinander auszuspielen. Beide haben einen ästhetischen Wert, den ich für meine Musik nutzen kann. Ich mag eine Vorliebe für ein bestimmtes Medium haben, weil es meiner angestrebten Ästhetik näher ist und sich daher meine Ideen damit besser umsetzen lassen – deshalb ist ein anderes Medium aber noch lange nicht unnötig. Die Entwicklung von Instrumenten hat die menschliche Stimme in der Musik auch nicht überflüssig gemacht, sondern sie ergänzt.
Wenn ich als Komponist*in für eine*n Musiker*in etwas Unspielbares schreibe, dann hat das einen Grund. Dann will ich Ungenauigkeiten hören, wenn viele Instrumentalist*innen rhythmisch nicht mehr exakt spielen können; dann liebe ich die Brüchigkeit des Klangs an der dynamischen Untergrenze eines Instruments; dann suche ich die Schwebungen, die aufgrund schwieriger Intonation in extremen Lagen entstehen.
Die Elektronik ernst zu nehmen hieße, sie als eigenständiges Instrument zu betrachten und in den ästhetischen Möglichkeiten zu nutzen, die sie von anderen Medien unterscheidet; sie als eine Erweiterung der ästhetischen Möglichkeiten zu begreifen, die aber selbstverständlich eine Musikkultur weiterführt und diese nicht „ablöst“ oder „aufhebt“.
Nun bezeichnet Lehmann den „ePlayer“ ja nicht nur als künstlerische Revolution, sondern vor allem als politische: Er führe zur „Demokratisierung des Orchesterklangs“, da „im Prinzip jeder und jede ein Orchesterstück schreiben und mit einigen wenigen Musikern auch zur Aufführung bringen kann“. Es wäre schön, wenn jede*r Komponist*in die freie Auswahl aus den existierenden Medien hätte. Aber dafür ist eine elektronische Orchesterimitation nicht die Lösung. Selbst wenn wir die Unaufführbarkeit eines Orchesterstücks „mit einigen wenigen Musikern“ einmal außen vor lassen; eine Samplelibrary befähigt mich auch nicht, ein Orchesterstück zu schreiben. Lehmann scheint zu glauben, dass die Wiedergabe mit Samplelibraries mir einen Eindruck dessen verschafft, was ich da für Orchester geschrieben habe. Nur ist das leider nicht die Realität. Nur drei Beispiele: Was für die jeweiligen Instrumente technisch möglich ist, spielt im „ePlayer“ überhaupt keine Rolle. Für Samples geschriebene Dynamik hat absolut nichts mit tatsächlicher Dynamik zu tun. Und wie Instrumentenverbindungen klingen oder wie es jenseits allen Klangs wirkt, wenn ein ganzes Streichorchester parallel die Bögen bewegt, das kann mir eine Samplelibrary auch nicht vermitteln. Wie Lehmann wiederholt die Entbehrlichkeit der Orchester herbeizuschreiben spielt im Zweifelsfall nur denen in die Hände, die Orchesterfusionen und -schließungen vorantreiben und hat so wohl eher das Gegenteil einer Demokratisierung zur Folge: noch weniger Komponist*innen, die mit Orchestern arbeiten können.
Arbeiten wir doch stattdessen lieber an einer tatsächlichen Demokratisierung: An mehr sozialer Durchlässigkeit im Ausbildungssystem von Musiker*innen, an mehr Musik von Komponistinnen im Repertoire, an mehr zeitgenössischer Musik in Konzertprogrammen und Opernspielplänen. Und arbeiten wir an einer Gleichberechtigung der musikalischen Medien: Elektronik ist nicht besser als ein Orchester, bloß weil sie jünger ist. Ein Orchester ist nicht besser als Elektronik, bloß weil es eine längere Tradition hat. Beide können mit den ihnen eigenen Qualitäten unsere Musik bereichern, und ich als Komponist bin sehr dankbar, dass ich für jedes Stück neu entscheiden kann, welches Medium das passende ist.