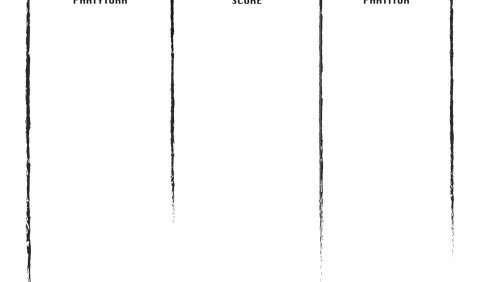Der 24. Februar 2022 ist zur Chiffre geworden. Vieles überlagert sich. Nichts ist gelöst. Der Schrecken dauert fort. Und das Eskalationspotenzial auch. Jenseits der Verlautbarungen herrscht Sprachlosigkeit. Nicht selten sind sie es sogar, die uns sprachlos machen. Nur, sprachlos bleiben ist auch keine Alternative. Ein Jahr nach dem 24. Februar 2022 scheint es an der Zeit, sich einmal zu erkundigen: Hat es in der Spanne dieses einen Jahres, über Statements von Komponisten hinaus, zuletzt noch in der aktuellen Ausgabe von „Musik & Ästhetik“, nennenswerte kompositorische Beiträge gegeben zum Thema? Solche mit Stil, Handschrift, Charakter, die dem Unverbindlichen wie der Phrase widerstehen?
Die Auswahl, die hier geboten wird, erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, auf Vollständigkeit schon gar nicht. Ihre Dramaturgie folgt gewissen Vorlieben des Autors für die Musikszenen Krakau und Heidelberg. Vorgestellt werden Kompositionen, die eines gemeinsam haben: Alle wurden nach dem 24. Februar 2022 uraufgeführt, alle beziehen sich, so oder so, auf dieses Geschehen. Dass die vorgestellten Arbeiten mehrheitlich Text-Vertonungen sind, kann kaum überraschen, stehen sie doch noch am ehesten im großen europäischen Echoraum von „War and Requiem“, der mit Schütz anfängt und mit Britten nicht endet. Allerdings – und dies ist dann doch einigermaßen überraschend – begegnet uns in diesem Kontext auch die reine Instrumentalkomposition, was natürlich zur Frage führt, wie der Bezug „24. Februar 2022“ ohne Worte herstellbar ist? Die Anschlussfrage lautet konsequenterweise, was diesen Bezug überhaupt stiftet? Was hat sie ausgelöst, diese kompositorischen Beiträge zum Krieg in der Ukraine? Natürlich wird sich zeigen, dass Aufträge im Spiel sind, klar. Aber, wer beauftragt und warum? Und noch dies: Eine der schönsten Entdeckungen wird sein, dass auch die Selbst-Beauftragung dabei ist. Das Künstler-Ethos scheint noch nicht ganz ausgestorben.
Schließlich die Rezeptionsebene. Was hören wir aus diesen Kompositionen? Ganz sicher nicht den Gestus einer älteren antifaschistischen Haltungs-Ästhetik im Stil des Nie-wieder-Krieg-Schwurfingers der Kollwitz. Verschwunden jenes Moment von Pathos, von dem wir annehmen, dass es irgendwie zu diesem Genre dazugehört, weil wir es von Picassos „Guernica“, von Schönbergs „A Survivor from Warsaw“, von Zimmermanns „Die Soldaten“ so gewohnt sind. Die Erde hat sich weitergedreht. Wenn es einen Grundton gibt in den hier vorgestellten Beiträgen, dann ist es der des Zorns, des Schmerzes.
Ein Generalstreik der Kunst?
„De omnibus dubitandum. Alles ist anzweifelbar“ – der schöne Grundsatz jeder halbwegs glaubwürdigen Recherche legt nahe, vorweg einen Standpunkt aufzurufen, der der skizzierten Versuchsanordnung grundsätzliches Misstrauen entgegenbringt. Eine Positionierung, die schon deswegen gewisse Beachtung verdient, weil ein Künstler sie vorträgt, seine grundsätzliche Unzuständigkeit erklärend: „Unmöglich ist, dass Kunst etwas bewirken könnte gegen den Krieg.“ Ein Statement des Komponisten Peter Ablinger, veröffentlicht an prominenter Stelle im Editorial der „MusikTexte“ August 2022. Ablinger hat das so jüngst noch einmal bekräftigt, als „Opposite Editorial“, also als eine Art „Gegen-Editorial“ in den „field notes“, dem Magazin für die Berliner Szene der Neuen Musik, deren Redaktion sich erkennbar irritiert zeigte angesichts solchen Schwankens zwischen „Abgrund und Aufruf zum Generalstreik“. Eine Alternative, bei der man tatsächlich eine gewisse Unbequemlichkeit fühlt, wobei Ablinger die Hilflosigkeit, die darin steckt, gar nicht in Abrede stellen möchte. Seine zum Thema entstandenen Text-Kompositionen – er nennt sie „Unmögliche Stücke“ – betrachtet er vielmehr „als einen Versuch, der Hilflosigkeit (der Kunst) zu entkommen, indem die Hilflosigkeit (als Kunst) artikuliert wird“. In jedem Fall lasse sich daraus ableiten, so Ablinger, „dass ich bezweifle, ob die Kunst oder Musik fähig sind, etwas beizutragen zu den großen ungelösten Problemen unserer Welt – außer Demonstrationen eines Gutmenschentums, außer ‚Greenwashing‘, Feigenblätter und Peinlichkeiten. – Der Generalstreik der Kunst wäre in diesem Kontext die Weigerung, da mitzumachen.“
Wer sich positioniert, heißt das, macht es nicht deswegen, weil er einen Weg aus der Sprachlosigkeit aufzeigen möchte, weil er die Destruktionsgewalt nicht unwidersprochen stehen lassen möchte, sondern er macht das, weil er vom Geltungsdrang besessen ist – nach dem Motto: Die Welt ist schlecht, aber wenn ich gegen die Schlechtigkeit der Welt protestiere, stehe ich selbst gut da! Eine Engführung, die jeden Versuch, sich der Wirklichkeit zu stellen, auflöst in Psychologie, andererseits mit maximaler Erwartung an die Kunst herantritt, um sogleich festzustellen: Es funktioniert nicht.
Zu fragen bliebe, wer eigentlich behauptet hat, dass Kunst „etwas bewirken“ können muss „gegen den Krieg“? So holzschnittartig vergröbert kommt man gar nicht umhin, den Gemeinplatz in Erinnerung zu rufen, dass „gegen Krieg“ niemand etwas „bewirken“ kann außer den jeweiligen Kriegsparteien. Was nicht heißt, dass Kunst in der Indifferenz verharrt, sich in Dekoration erschöpft. Kunst ist Echoraum. Wie „Guernica“ Echo war auf das, was Guernica geschah, wie „A Survivor from Warsaw“ Echo darauf war, was den Juden geschah. – Und heute? Deutet einiges darauf hin, dass die großen künstlerischen Manifestationen, die schuldhafte Vergangenheit aufrufen, um ihr gleichzeitig den Prozess zu machen, sich aus der Musik zurückgezogen haben. Sie kommen nicht mehr vor – so wie sie in der Bildenden Kunst der Gegenwart, in den verbergenden, übermalenden Gesten eines Anselm Kiefer, eines Gerhard Richter vorkommen. – Was also machen Komponisten, die im Hallraum des 24. Februar willens sind, gegen die Sprachlosigkeit anzutreten? Sie entdecken, dass sie selber Teil von Sprachlosigkeit sind.
Ein Konzept
Dass eine der ersten kompositorischen Reaktionen auf das Geschehen des 24. Februar 2022 ausgerechnet ein Konzeptstück gewesen ist, ist sicher kein Zufall. Und, dass es aus Polen kommt, wohl auch nicht. Andererseits, was unterscheidet Marcin Stanczyks „Impossible music (24.02.2022)“ von den „Unmöglichen Stücken“ Peter Ablingers? – Eine erste Antwort wäre, dass darin festgehalten wird an der Idee des Echoraums. Wenn etwas unmöglich ist (an dieser Paradoxie kommt man kaum vorbei), kann es doch möglich werden. Nicht vorzeitig die Akte schließen, in die Wiederaufnahme gehen, lautet der kategorische Imperativ dazu.
„Das Stück besteht aus dem Titel und dem freien Raum, der gefüllt werden soll mit den Gedanken der Interpreten, dem Inhalt ihrer eigenen Überlegungen. Ich sehe mich nicht in der Lage, diese Gedanken zu erraten. Der vollständige Inhalt der Arbeit ist daher unbekannt. Er wird ständig aktualisiert.“
Ein Echo auf den Schock des 24. Februar, das seinerseits auf ein Echo wartet. Was Letzteres auslöst, sind Fragen. Fragen nach der Möglichkeit von Musik unter der Drohung der Sprachlosigkeit. Marcin Stanczyk, Komponist, Jahrgang 1977, hat, unter anderen, diese:
„Gibt es Musik, die wir niemals
hören möchten?
Was ist Musik angesichts
außermusikalischer Inhalte, die sie
ausfüllen, manchmal sogar vollständig?
Was ist Musik in Zeiten des
Informationschaos?
Kann der Inhalt der Musik das
Unausgesprochene sein?
Ist Musik noch möglich?
Brauchen wir noch Musik?“
Bliebe die Frage, wie sich ein solches Stück „Impossible Music (24.02.2022)“ im politischen Raum verhält? Dazu dieser Minidialog mit dem Komponisten, geführt in einer Krakauer Hotellobby: “Can the piece performed everywhere and by everyone? – Of course! – Also in Russia? – (nach einem Zögern) Yes! – Also by Russians? – Yes, it could be good to be performed by Russians!” „The Russians“, „die Russen“ mithineinnehmen in die Frage, die der Hallraum eines 24. Februar 2022 aufwirft.
Eine Frage der Würde
Was bewegen will, muss selber ausgelöst werden. Brechts schöne „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“ sagt nichts anderes. Erst der Auftrag des Zollverwalters macht den weisen alten Mann, macht Laotse zum Autor einer, wie Brecht das sieht, Resistance-Philosophie. „Darum sei der Zöllner auch bedankt / Er hat sie ihm abverlangt.“ Ohne die Parallelen überzustrapazieren, lässt sich doch sagen, dass Produktivität und Beauftragung, dass Komposition und der Auftrag dazu in starker Kausalität stehen. Zumal in diesem Fall, wo gut die Hälfte der vorgestellten Kompositionen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine sich einem künstlerischen Epizentrum verdanken, das hierzulande seinesgleichen sucht, ohne, dass sich das doch schon überall und in gebührender Weise herumgesprochen hätte. Dass Musik den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie entsteht, nicht negieren darf, dass sie ihn im Gegenteil mitdenken muss – in dieser Überzeugung hat Walter Nußbaum das KlangForum Heidelberg gegründet und 30 Jahre in diesem Sinne künstlerisch geleitet.
KlangForum Heidelberg – das sind zwei Exzellenz-Initiativen der künstlerischen Performance: Schola Heidelberg, ein aus Solisten bestehendes Vokalensemble, das sich anlehnt an die spätmittelalterliche frühe Mehrstimmigkeit und ihre Sängerschulen, deren Bildungshorizont weit und tief gewesen ist, sich nicht allein in Techniken der Ausführung erschöpfte. Neben der Schola, Pendant zum Vokalen, agiert, musiziert mit ensemble aisthesis ein Instrumentalensemble, das ein Verständnis von Wahrnehmung ins Spiel bringt, wie es die Philosophen im alten Griechenland gelehrt, geschätzt haben. Die „Freude an der aisthesis“, so kann man das beim Philosophen Aristoteles nachlesen, „die Freude an den Sinneswahrnehmungen zeigt, dass die Menschen“, sagt Aristoteles, „nach Wissen streben“.
Dafür, für solcherart Übergänge vom Sinnlichen, vom Wahrnehmbaren ins Denken und Nachdenken interessieren sich die KlangForum-Musiker, interessiert sich insbesondere ihr Dirigent und künstlerischer Leiter Walter Nußbaum. Er war es, der 1992 die Gründung von Schola Heidelberg und ensemble aisthesis initiiert hat, um beide Formationen unter das Dach von KlangForum Heidelberg e.V zu stellen. Seitdem konzertiert man auf nationalen wie internationalen Festivals, bei namhaften Veranstaltern, aber auch regelmäßig in Heidelberg selbst.
Wie zuletzt im Herbst 2022, im Jubiläumsjahr, als man eine ganze Serie von Konzerten projektiert, thematisch kontextualisiert hat. Schlussendlich waren das fünf Konzerte, die mit der Menschenwürde ein Thema variierten, das bekanntermaßen nicht verhandelbar ist, ohne dass zugleich die Momente ihrer Gefährdung, Verletzung ins Spiel kommen. Mit der Frage, ob dies Aufgabe eines Musikfestivals ist, hat sich die künstlerische Leitung um Walter Nußbaum, Ekkehard Windrich und Marc Reichow nicht lange aufgehalten. Von Anfang an gehört es zur Praxis von KlangForum Heidelberg, Kunst auszulösen, die den politischen, den gesellschaftlichen Kontext ihrer Gegenwart mitreflektiert.
So standen im vergangenen Oktober ein Matinéekonzert sowie ein großes Abschlusskonzert ganz im Dienst künstlerischer Reaktion auf das Geschehen in der Ukraine, woraus nun nicht zu folgern ist, dass Heidelberger Kuratoren hellseherische Fähigkeiten hätten. Niemand, der bei den weit zurückliegenden Planungsgesprächen ahnen konnte, was da auf die Welt zurollt.
Nach dem 24. Februar war es anders. Auf einmal war klar, dass ein Krieg in Europa zum Dauerthema der politischen Nachrichten werden würde, um damit zugleich den schönen Künsten ein Problem zu bescheren. Was hierbei das zu kuratierende Jubiläumsfestival „Die Würde – wessen?“ anging, reagierte KlangForum Heidelberg mit Nachsteuern, mit in letzter Minute in Auftrag gegebenen Werken – auch dies eine Frage der Würde. Im Ergebnis stand auf der Haben-Seite ein dankbares Heidelberger Publikum, das dem aufgespannten Echoraum seine ganze Aufmerksamkeit schenkte. Man spürte: Was hier zur Aufführung kommt, kommt aus einem Inneren, das unser aller sprachlos sein beenden möchte, indem es bereit ist, zu übersetzen, was sich gegen alles Übersetzen sperrt. Letzteres korrelierte im Übrigen aufs glücklichste mit der These der auf dem Festival vortragenden Neurobiologin Hannah Monyer, wonach unser Gedächtnis keineswegs, wie immer wieder nachgeplappert wird, aus irgendwelchen „Abdrücken“ besteht. Gedächtsnisarbeit heißt „permanente Rekonstruktion“. Der Geist ruht nicht.
Eine Wunde, eine Geste
Zustandegekommen ist so auch eine Komposition, die ganz aus humanistischem Erbe gedacht ist. Ein Reflexionsraum, der aus Unkenntnis und Fahrlässigkeit heute leider oft ausgeblendet wird.
Stefan Litwin hat sich daran erinnert. In diesem Fall an die Epoden des Horaz. Epode für Nachgesang, Schlussgesang, wobei die Wimpernschlag-Kürze seiner Arbeit – „An die Römer“ für Tenor und Klavier – nicht so sehr Tribut ist an den Zeitdruck, unter der sie entstand, als dass in ihr das Bewusstsein für Gefasstheit des Ausdrucks bestimmend ist. Ein Stück, das den Druck von außen in die Getriebenheit von Sprech- und Klavierstimme zurückverlagert. Zwischen dem „Wohin stürmt ihr Verruchten, wohin?“ und dem finalen „Zum Fluche noch den Kindeskindern“ bleibt die Frage nach dem „Warum“ unbeantwortet. Zwei Mal wird ein „Antwortet!“ verlangt. Die Muster wiederholen sich in zweitausend Jahren, sagt der Komponist. Horaz, sagt Litwin, hat „erschreckende Aktualität“. „So lag die Wahl eines für den Augustus-Apologeten Horaz ungewöhnlich pazifistischen Textes über den fundamentalen römischen Bruderzwist auf der Hand.“ Sebastian Hübner begleitet von Marc Reichow am Klavier. Der Solist der Schola Heidelberg in jeder Sekunde dieser drei hochverdichteten Minuten textverständlich. Scharf im Ausdruck beide.
Dann das große, „Geist.Natur.Gewalt“ überschriebene Abschlusskonzert. Ehe dessen Finale in einer bewegenden, selten zu erlebenden Aufführung von Hanns Eisler: „Bilder aus der Kriegsfibel“ erreicht war, ging der Blick zu den Sternen und von dort zurück auf die Erde, auf ein blutbeflecktes, blutgetränktes Stück Erde. Dass dieses heute in Europa lokalisierbar ist, gehört, so Marc Reichow im Vorwort des Programmbuchs, zur „barbarischen Gegenwart von 2022“. Dann aber dies: In Gestalt der beiden Uraufführungen kam es, gegen alle Erwartungen, zu einem berührenden Moment von Künstler-Freundschaft, die es eigentlich gar nicht geben darf. Dass sich Maxim Kolomiiets, 1981 in Kiew, und Sergej Newski, 1972 in Moskau geboren, vor dem Publikum der Heidelberger HebelHalle als Freunde präsentierten, dass sie ihren Stücken wechselseitig Aufmerksamkeit entgegenbrachten, dass sie Seite an Seite zum Gespräch bereit standen und dass sie den Krieg, den ihre Länder austragen, nicht untereinander austragen – es war die beglückende Versöhnungsgeste dieses Festivals. Backstage langes Verweilen des künstlerischen Leiters mit seinen beiden Komponisten.
Und im musikalischen Teil? – Hielt ausgerechnet der Beitrag des russischen Komponisten Sergej Newski den Finger in die tiefe Wunde, die am russischen Körper aufgeplatzt ist. Was aussteht, was in Frage steht, konstatierte jüngst Michail Schischkin, ist die „Rückkehr Russlands zur Menschlichkeit“. (FAZ, 10.01.) Bestürzung, Bitternis ist heute wohl die wahre Grundstimmung unter russischen Intellektuellen, Künstlern, Musikern, zumal bei denen, die, wie der Wahl-Berliner Newski, im Ausland leben. „Eyewitness-evidence“ hatte dieser sein Stück überschrieben, also etwa: „Augenzeugenschaft-Deutlichkeit“. Tatsächlich lässt das vertonte Gedicht des jungen russischen Poeten Dmitry Gerchikow daran nichts zu deuteln übrig. „Krieg hat das Gesicht“ – so beginnen 39 Zweizeiler. Wie im Alptraum zieht vorbei, was Gerchikow gesehen hat: mit eigenen Augen auf der Straße, auf Fotos, im Traum. Entstanden sind Verse, die den Realismus Dostojewskis heraufbeschwören als seien sie aktuelle Fußnoten zu „Aufzeichnungen aus einem Totenhaus“.
„Krieg hat ein älteres Gesicht,
geboren 1937,
befleckt mit Kohle und Blut
Krieg hat ein hübsches Gesicht
eines Mannes, geboren 1989,
mit ausgeschlagenen Vorderzähnen
Krieg hat das Gesicht eines 1996
geborenen besten Freundes
er ist micht mehr wiederzuerkennen
Krieg hat ein Gesicht, das ich 2001
während eines Albtraums
im Spiegel sah“
Eine Frage des Ethos
Die Frage, ob die öffentliche Aufführung eines auskomponierten Anti-Kriegsgedichts für seinen russischen Autor nicht lebensgefährlich sei, bejahte Newski unumwunden, weswegen er auch gewartet habe bis Gerchikow außer Landes gekommen sei. Realität im europäischen Herbst 2022.
Solcher Bitterkeit stellte die Auftragskomposition von Maxim Kolomiiets ein Moment von poetischer Verträumtheit zur Seite, freilich auf einem Fundament von gehärtetem Realismus der Großstadt. Eine Grundspannung, die sich Kolomiiets von seiner Textvorlage geborgt hat. „Seid ihr bereit?“, auch das Gedicht des aktuellen Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels Serhij Zhadan stellt Naturhaftes neben Bilder aus Operationssälen und Schlachthäusern, ganz in der Manier eines Gottfried Benn. „Seid ihr bereit über den Abend zu sprechen, / wie sie im OP über den Tod sprechen?“ Parallele Welten, die auch die Instrumentierung nachvollzieht.
Auf einen Vokalsatz aus fünf hoch geführten Stimmen versetzt Kolomiiets ein Schlagzeug, ein Klavier in rhythmisches Flackern. Eingewobene Harfenlinien scheinen Verbindlichkeit zu signalisieren. Das Stück schwebt vorüber. Noch sein Titel „Mond und Steine“ verstärkt den Eindruck einer großen Vorsicht, einer Scheu, ausgelöst durch die Sorge, komponierend ins Abbildhafte zu verfallen. Auch Kolomiiets geht es um den poetischen Raum. In jedem Fall mehr Haltung als Fotografie. „Zusammenhalten, beim Licht, / zusammenhalten unter den Flügeln“. Was von Belang sein will, muss seine Umgebung im Auge behalten. Ob das Werk gelingt (was hier zunächst einmal bedeutet, ob es Gegenwärtigkeit an den Tag zu legen vermag), hängt ab von Bedingungen, die es nämlich selber weder beeinflussen, noch garantieren kann, die gleichwohl über sein Schicksal mitentscheiden. Will sagen: Einen Auftrag zu erfüllen, kann durchaus dazu nötigen, die Buchstaben einer Verabredung zu ändern, um ihren Geist zu retten. Ein instruktives Beispiel für diesen Zusammenhang liefert eine aktuelle Chorkomposition, entstanden im Auftrag des Deutschen Musikrates für den Bundesjugendchor. Die Entstehungsgeschichte dieser Komposition reicht zurück in die Zeit vor der ausgerufenen „Zeitenwende“. Für den neugegründeten Chor zwecks „Förderung des Spitzennachwuchses“ hatte sich seine Leiterin Anne Kohler neue Beiträge aus dem Kreis der Gegenwartskomponisten gewünscht. Die Wahl fiel in diesem Fall (ein Fingerzeig von Walter Nußbaum) auf den früheren Lachenmann-Schüler Jan Kopp. Nicht unwichtig in diesem Zusammenhang, dass sich dessen künstlerische Entwicklung in engem Austausch mit KlangForum Heidelberg vollzogen hat. Ein Stück wie „Ode an das Sägemehl“ für achtstimmigen gemischten Chor, so bekennt der Komponist, hätte er ohne diese Erfahrung gar nicht schreiben können.
Doch wie ist es zu diesem fakturierten, den semantischen Raum zerschießenden Chorstück überhaupt gekommen? Vorgegeben vom Auftraggeber war nämlich zunächst einmal nur dies: „Mensch und Wald“, was erkennbar im Atmosphärisch-Ungefähren verharrt. Gleichwohl: Für den März 2022 hatte sich Kopp doch vorgenommen, das Stück zu komponieren. Als dann aber die große Politik die Szenerie nachhaltig verschattet hatte, war dem Komponisten klar: „Ich kann das Stück so nicht schreiben.“ Eine fieberhafte Suche begann. Irgendwann eine Zeitungslektüre und ein Zufallsfund, ein Gedicht des russischen Poeten Alexej Porvin: „Ode an das Sägemehl“. Darin ist von „Verhörräumen“, „Splittern“, „Gefängnissen“ die Rede. Eine Strophe geht so:
„Die russischen Wälder gehen in
ukrainische über
nicht in echt zwar, aber die Leute
sagen so,
die russischen Wälder gehen in
Pulver über,
um als Sägemehl alles Gegebene
aufzusaugen.“
Auch hier also ein bissiger, selbstkritischer Ton, eine verzweifelte Geste und am Ende ein Ausruf, der der Käthe Kollwitz mit Sicherheit sehr gefallen hätte: „Waffen weg!“ Komponist Jan Kopp wirft das Ruder herum, und hält sich in Sachen Form ans Bild des Mehls, also an etwas, das unter den Fingern zerrinnt. Was an Konturiertem anfänglich noch halbwegs da ist, zerfällt im Fortgang des Stücks, wird Cluster, wird Geräusch, womit die Aufgabenstellung für den ausführenden Bundesjugendchor klar definiert ist: den Zerfallsprozess nachvollziehen, ohne den Zusammenhang preiszugeben.
Eine Komposition im Hallraum des 24. Februar, die die Pulverisierung von allem und jedem in eine Form übersetzt, so der Unverbindlichkeit, der Indifferenz, dem größten anzunehmenden Sündenfall, entgeht. Nach der Uraufführung des Stücks im Juni 2022 in der Tauberphilharmonie Weikersheim folgte die Aufzeichnung beim SWR. Album und gedruckte Partitur werden für das Frühjahr erwartet.
Eine Situation im Osten
Krakau, Anfang Dezember. Das Abendprogramm des KTO Teatr im 13. Bezirk lockt an diesem trüb-kalten Samstag zahlreiche Besucher. Was nicht weiter verwundert. Erstens hat Krakau ein kunstinteressiertes Publikum, das wissen will, was in Sachen Theater, Tanz, Konzert vor sich geht, ein Anliegen, das dieses Haus, architektonisch ein Kubus, den man in ein altes Kino hineingesetzt hat, nach Kräften bedient.
Hinzukommt, dass an diesem 3. Dezember gleich eine doppelte Premiere angekündigt ist. Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, die in Krakau ansässige Formation für Gegenwartsmusik, 2014 gegründet, 2022 mit dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung ausgezeichnet, konzertiert zum ersten Mal mit dem ersten Komponisten Polens, mit Zygmunt Krauze, Jahrgang 1938. Eine Konstellation, die auf eine Einladung Krauzes zurückgeht und die die Ensemblemitglieder, die ehrfurchtsvoll nur vom „Herrn Professor“ sprechen, in Verzücken versetzt hatte. Aber auch umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Als Krauze Spółdzielnia Muzyczna, auf Deutsch in etwa: „Musikalische Genossenschaft“, vor zwei Jahren bei einer Jury kennengelernt hatte, habe er sich, erzählt er, lebhaft erinnert gefühlt an seine Zeit in der Warsztat Muzyczny, der „Werkstatt Musik“, einem Ensemble, das er 1967 ins Leben gerufen hatte und das in der Besetzung Klarinette, Posaune, Cello, Fortepiano über zwanzig Jahre unverändert aufgetreten ist. Dieses Déjà-vu sei schon sehr berührend gewesen, sagt Zygmunt Krauze. Was sie damals gemacht hätten, neue Stücke aufzuführen, neue Klänge zu entdecken, Aufträge zu vergeben – das mache jetzt dieses Ensemble, weswegen er als alter Hase den Youngstern den Vorschlag unterbreitet habe, ein Stück für sie zu schreiben, mit ihm selber am Klavier.
Ob diese angekündigte Krauze-Uraufführung zusätzlich Publikum gezogen hat, lässt sich kaum beurteilen. Eine Musik „für elektronische Klänge und acht Instrumente“ muss notwendig abstrakt bleiben. Und ein lateinischer Titel muss ebenso notwendig mehr verhüllen als er offenlegen kann, weswegen das einführende Gespräch mit dem Komponisten beinahe mit derselben Spannung erwartet wird wie das Konzert selbst. Ausverkauftes Haus. „De ira, de dolore“. Was soll uns das werden? steht in den Gesichtern geschrieben. – Als Einstieg bietet die Moderatorin eine Sicht auf das kompositorische Werk Krauzes an. Dahinter, sagt sie, stehe als treibende Kraft die Irritation, woraufhin Krauze bemerkt, dass es um mehr gehe als um Irritation. Da seien immer Gefühle, in diesem Fall solche von extremer Natur, was sich ja auch im Titel ausdrücke: „De ira, de dolore“. „Über den Zorn, über den Schmerz“. Und, um deutlich zu machen, was wiederum dahinter steht, schiebt Krauze diesen Satz nach: „Es geht um die Situation, die wir im Osten haben.“
Ein Moment, in dem jeder im Raum versteht, was gemeint ist, auch wenn die gerade in Polen an dieser Stelle eigentlich fälligen Schlüsselwörter der Parteinahme vermieden werden. Es schmerze ihn sehr, sagt Krauze, „dass dies geschieht“, um im nächsten Moment einen Blick in seine Werkstatt freizugeben. Es sei nicht das erste Mal, dass seine Arbeit durch eine menschliche oder politische Situation ausgelöst worden sei. Auf die Ausrufung des Kriegsrechts in Polen 1981 habe er „Tableau vivant“ geschrieben, auf die Flüchtlingskrise in Europa „Exodus 2016“. Zahlreiche andere Beispiele könne er anführen.
Auch im persönlichen Gespräch lässt sich der Komponist nicht mehr entlocken. Er habe keine Ratschläge für andere und auch keine zu erteilen, sagt Zygmunt Krauze. Mit seiner Musik drücke er allein sich selbst aus. Er registriere sehr genau, was um ihn herum vorgeht. Und deswegen sei eben jetzt dieses „De ira, de dolore“ hinzugekommen. Woran man merkt, dass sein Stück diesen politischen Bezug hat? Das verrate der Titel, sagt Zygmunt Krauze. – Und das Stück? Wovon spricht es? An der Klarheit der Formgestalt, die es findet, wird spürbar, nicht anders wie in den anderen der hier vorgestellten Beiträge, dass es dem Komponisten um ein Widerstehen unter der Drohung von Sprachlosigkeit zu tun ist. Auch „De ira, de dolore“ für elektronische Klänge und acht Instrumente ist kein Stück „über den Krieg“, sondern ein Stück über Emotionen, die ein Krieg, respektive eine „Situation im Osten“, ausgelöst haben. Eine Differenz, die man nicht als bloße Spitzfindigkeit missverstehen sollte, geht es doch immer auch darum, zu vermeiden, unbedarft in die alte Widerspiegelungsfalle zu tappen.
Ist diese Hürde einmal genommen, liegt sie offen, die Intelligenz dieser Instrumental-Komposition. Da sind die Aktionen, die mit großem Druck, schrapnellartig und keiner offensichtlichen Regel gehorchend, aus dem Ensemble abgesondert, abgeschossen werden. Sie treffen auf Klangfelder, die Krauze mit Hilfe seines ehemaligen Schülers Wojciech Błazejczyk, aus Klavierklängen gewonnen, elektronisch transformiert hat. Knapp zwei dutzend Audio Files, die sich an den Enden überlappen, die sich nicht vertreiben lassen, die auf ihrem Dasein, ihren dynamischen Rechten beharren, nicht zurückstecken hinter den konkreten Klängen aus dem Ensemble, nur, dass es so etwas wie Gegenbilder sind: „harmony“ und „quietness“, sagt der Komponist. Dazu tritt, in der Mitte des Geschehens taucht es auf, ein Zitat, das Krauze in den Veröffentlichungen des deutschstämmigen Musik-Ethnographen Oskar Kolberg (1814–1890) gefunden hat. Schrill liegt dieser Melodiefetzen in der Piccoloflöte.
Eine Erinnerung an Rotruthenien, eine Gegend um Lemberg in der heutigen Westukraine. Man muss ein polnischer Komponist sein, um solches Material ins Spiel zu bringen.
Hör-Tipp
Deutschlandfunk, 21.02.2023
Musikszene, 22:05–22:50
„DE IRA, DE DOLORE“ – Aktuelle Kompositionen zum Krieg in der Ukraine. Eine Sendung von Georg Beck.