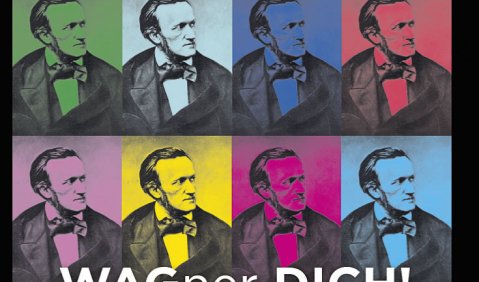Partizipative Formate haben in der Musikvermittlung eine lange Tradition und orientieren sich an einem noch älteren gesellschaftspolitischen Ideal: dem der Mitbestimmung und politischen Mitgestaltung1.
Spätestens seit der digitalen Verfügbarkeit von Musik und der Kommunikation in Social Media hat kulturelle Partizipation jedoch eine Steigerung erfahren, die streng genommen ihre ursprüngliche Bedeutung als „Teilhabe“ und „Mitmachen“ korrumpiert2. Man hat nicht mehr an einem „Werk“, einer Gemeinschaft, einer Kunstaktion teil, sondern man erfindet sie oder gestaltet sie neu. Dies geschieht im Kontext digitaler Medien individuell oder aber in neuen Formen der Kollaboration und Ko-Kreation und erzeugt, ja feiert zuweilen geradezu eine Pluralität von „Werken“ und Wahrnehmungen, die der Idee des Repräsentativen eine strikte Absage erteilt.
Das Thema Partizipation in der digitalen Musikvermittlung beschäftigt uns als Dozierende für Musikvermittlung an der Anton Bruckner Privatuniversität (in Linz/Oberösterreich). Wir beginnen unseren Text zunächst mit einigen Beispielen aus dem Radio (Ö1/ORF), das längst auch ein Internetformat geworden ist, um danach die hier gelungene Partizipation auf Theorie und Praxis der Musikvermittlung zu beziehen, wie sie auf Konzertbühnen, Festivals, in Workshops und Schulen zu finden ist.
Walkürenritt und Ode an die Freude
Als sich 2013 der Geburtstag Richard Wagners zum zweihundertsten Mal jährte, war wie gewöhnlich in Medien- und Konzerthäusern ein „Wagnerjahr“ unumgänglich. 2013 war also die Frage (bei uns in der Musikredaktion von Ö1, dem Klassik- und Kultursender Österreichs), wie begehen wir das Jubiläum eines Komponisten, der immer eine eingeschworene Gemeinde von Enthusiasten hatte und bis in die Gegenwart hat, andererseits aber von einem großen Teil der Klassikfans und -liebhaber abgelehnt wird, wegen seiner bombastischen Attitüde, seines selbstherrlichen Deutschtums und nicht zuletzt seines offenen Antisemitismus‘. War „Musikvermittlung“, so wie wir es im Radio gewohnt sind, mit der Präsentation selten gehörter Werke, besonderer Interpretationen, aktueller Informationen, hier sinnvoll? Die Wagnergemeinde braucht so etwas nicht und die Wagnergegner wird es kaum erreichen.
Darum haben wir den Spieß umgedreht und auf eine in der Radiogeschichte eigentlich alte Methode der Partizipation zurückgegriffen – scheinbar zurückgegriffen, denn genau genommen ging es im ‚Gewand‘ einer Teilhabe um eine Neuerfindung. Partizipation kennt die Geschichte des Radios als „Wunschkonzert“: Hörerinnen und Hörer wünschen sich ihre Stücke und artikulieren möglicherweise ihren Wunsch als O-Ton. Wir hingegen haben die Devise ausgegeben „WAGner DICH!“ und die Hörerinnen und Hörer eingeladen, den Ritt der Walküren neu zu vertonen.3
Der grundsätzliche Unterschied zum erwähnten Wunschkonzert ist, dass wir nicht nach Defiziten gesucht haben, um sie auszugleichen, wie etwa Wünsche, die befriedigt werden, mangelnde Information, die ausgeglichen wird, oder mangelndes Interesse, das durch besonderen Witz, Details und Geschichten in Neugier verwandelt wird. Wir haben die Ressourcen nicht bei uns und der Musik gesehen, sondern beim Publikum, das Wagners Walkürenritt neu arrangieren, umkomponieren, dekonstruieren, verhöhnen und verspotten oder einfach schlicht neu komponieren sollte. Über 70 zirka dreiminütige Beiträge sind damals eingegangen mit einem bunten Reigen musikalischer Genres: von Rap bis Techno, klassisch instrumental bis elektronisch experimentell, Jazz, Folklore oder Stilfusionen (Wagner im Klezmer-Stil oder der Walkürenritt als Westernmusik à la Morricone). Ein Glanzstück der Dekonstruktion war die von zwei Hörern gesendete Version des Walkürenritts für zwei Schreibmaschinen, inklusive Partitur.
Noch größer war die Resonanz bei einer ähnlichen Aktion des gerade vergangenen Beethovenjahres: Hier haben wir ausgehend von Beethovens allgegenwärtiger Hymne auf Schillers Ode an die Freude die Hörerinnen und Hörer gefragt: „Wie klingt Freude? – Komponieren Sie drei Minuten Freude … Schicken Sie uns ein File (max. 3 Minuten) mit Ihrer Komposition zum Thema Freude – gemeinsam mit oder ohne Beethoven und Schiller.“4 Über 170 Beiträge sind diesmal eingegangen. Viele davon haben das Thema ‚Freude‘ stark auf die Coronapandemie bezogen, manche auf Beethovens Freude-Thema (brasilianisch, gerappt oder neu getextet), andere schlicht eine Szene oder Stimmung der Freude vertont.
Corona-Ode an die Freude
Corona-Virus, Menschheitsgeisel,
du schwirrst um die ganze Welt,
wirbelst wie ein Riesenkreisel, schlecht ist es um uns bestellt.
Menschenleere in den Straßen,
fliegerlos das Himmelszelt.
Niemand kann den Wahnsinn fassen, der Natur dies doch gefällt.
(Beitrag einer Hörerin, gesungen auf Beethovens „Ode“, Ö1 / Wie klingt Freude? Mai 2020)
Die Hörer*innen werden durch keinerlei Preise oder Auszeichnungen zum Mitmachen gelockt. Es gibt keine Gewinner oder Ranglisten; alle Beiträge werden (samt Kommentaren, Texten etc.) nachhörbar auf die Homepage des Radioprogramms von Ö1 gestellt, manche davon im Programm gespielt.
Aktionen dieser Art sind in anderen Bereichen des Radios noch viel verbreiteter und funktionieren hier ebenso, wenn nicht besser: Da werden Kochrezepte oder Gartentipps ausgetauscht, gedichtet, gemalt, gefilmt, Geschichten, Erlebnisse oder Ratschläge gesammelt, auf der Homepage präsentiert und oftmals mit Sendungen verknüpft. Die Musik hat sich hier lange Zeit schwergetan, das Publikum einzubeziehen. Das erwähnte Wunschkonzert hielt daran fest, die Musik selbst nicht anzutasten. Dieser Respektabstand, die Unantastbarkeit der „großen Werke“, schafft eine Distanz, die man zelebrieren und genießen oder aber mit Lust auflösen kann. Bei „WAGner DICH!“ oder „Wie klingt Freude?“ hieß es nicht mehr: „mach mit“, sondern „mach es“, gestalte die Musik selbst.
Man könnte es eine neue Dimension oder Stufe dessen nennen, was der Mediendramaturg Christian Mikunda einmal den „Grad der Involviertheit“ nannte5: eine ‚Position‘ der Rezipient*innen, die unmittelbar aktiviert, auch wenn es mühsam, schwierig und anspruchsvoll ist. Die unterschwellige Belohnung ist nicht der Glanz eines Preises, sondern die Lust, Barrieren und Distanzen zu überwinden, die Hermetik der großen Werke zu durchbrechen – nicht Teil zu haben, sondern Teil zu sein von Kunst (jetzt in einem neuen, radikaleren Sinne von Partizipation).
Musikvermittlung als musikalisches Involvieren
Möglichst barrierefreie Zugänge zu schaffen und Brücken zum Publikum zu bauen, sieht auch die Musikvermittlung von Musikensembles und Musikinstitutionen (wie Konzerthäuser oder Festivals) als ihren Auftrag und versucht, mit partizipativen Formaten das Publikum zu involvieren. Insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik haben Response-Projekte, in denen Laien mit eigenen musikalischen Kreationen eine Antwort auf bestehende Kompositionen geben, eine lange Tradition. Während jedoch im Radio – wie beschrieben – das Publikum dazu eingeladen wird, ganz frei und selbstständig eigene Versionen und Stücke zu schaffen, gestaltet sich dies in der Live-Situation und in der Arbeit mit einer Gruppe als anspruchsvoll: Das kollektive Komponieren braucht besonders viel Zeit für Aushandlungsprozesse und bedarf einer Anleitung von Expert*innen. Für viele Musiker*innen ist dieses Arbeitsfeld jedoch sehr fremd, denn sie sind auf das Interpretieren, nicht jedoch auf das Komponieren oder Umarbeiten von Musikstücken spezialisiert und fühlen sich einer Werktreue und historisch informierten Aufführungspraxis verpflichtet. Musikvermittler*innen hingegen, zu deren Handwerk das Anleiten von kreativen Gestaltungsprozessen gehört, profitieren hier von langjährigen Erfahrungen aus der Musikvermittlungsszene, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum, und führen partizipative Projekte wie beispielsweise Stadtteilopern6 durch. Bei so großen Projekten ist es verständlich, dass eine künstlerische Leitung Entscheidungen trifft und damit den Grad der Partizipation einschränkt; dennoch fühlen sich die Beteiligten in der Regel als Mitgestaltende und sind stolz auf ihr gemeinsames Werk – sie erfahren also ein Empowerment.
Doch auch wenn partizipative Musikvermittlungsformate ressourcenorientiert vorgehen, unterscheiden sie sich von den geschilderten Radioprojekten in wesentlichen Punkten: So sind die komponierenden Radiohörer*innen ganz frei in ihren Entscheidungen und genießen in der Autonomie und Anonymität einen gewissen Schutz und eine Narrenfreiheit. Das Radio schafft einen Rahmen, bietet ihnen einen Raum und Reichweite. Mit dem entscheidenden Wechsel von „mach mit“ zu „mach es“ wagt sich das Radio nicht nur, ein Sakrileg zu begehen, indem es zur Stürmung von „Werken“ aufruft, sondern es gibt auch selbst Deutungshoheit ab. Das Ausstrahlen und Hören der Kompositionen von Radiohörer*innen und nicht nur das Erfüllen von deren musikalischen Wünschen bedeutet einen „social turn“, der viel weiter geht als eine Publikumsorientierung: Die Rezipient*innen werden hier zu Autor*innen.
Virtuelle Partizipationsformate
Digitale Medien – die in der aktuellen Pandemie besonders virulent geworden sind – können mit eigenen künstlerischen Mitteln genutzt werden und bieten eine Reichweite und ein Forum für Partizipation, wie dies im Konzerthaus nie möglich wäre. Das Internet als künstlerisches und soziales Medium zu nutzen heißt jedoch nicht nur, ein Konzert nach dem anderen zu streamen und journalistisch zu „promoten“. Es bietet vielmehr im Sinne des vorgestellten Radioprojekts auch die Möglichkeit, eine breite Community mit einem Impuls oder einer Frage zur Mitwirkung einzuladen und ihr dann auch zuzuhören.
Corona als Generalpause bedeutet keine absolute Stille, sondern eine Chance, genauer hinzuhören und bisher ungehörte Stimmen zu vernehmen und einzubeziehen. Dies kann eine unerhörte Wirkung entfalten: Denn in der momentanen Situation, in der der Musikbetrieb gelähmt scheint, zeigen sich die Notwendigkeit und das Potenzial von Musikvermittlung, Beziehungen zu stiften und Starres in Bewegung zu versetzen, in besonderem Maße. Digitale Formate bieten ganz neue Chancen der Partizipation und dabei gewonnene Erfahrungen können wiederum in analoge oder hybride Formate fließen. Gleichzeitig soll die direkte, physische Interaktion, die in der digitalen Welt so schmerzlich vermisst wird, in Zukunft auch in neuen oder erweiterten Konzertformaten viel bewusster ins Zentrum gerückt werden.
Musikvermittlung 2.0
Dass die Community der Musikvermittlung im Internet vielfältige Erfahrungen mit digitaler Interaktion sammelt, beweist ein Blick auf die Website des Netzwerk Junge Ohren. Da finden sich Angebote für Mitmachkonzerte (z.B. MusikLab der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen), Austauschplattformen mit Musiker*innen (z.B. Videochats mit Musiker*innen des BR-Symphonieorchesters) oder künstlerisch-kreative Räume für eigene Kompositionen und Improvisationen (#Utopera der Wiener Staatsoper). Besonders anregend für ein Entwickeln von neuen interaktiven digitalen Formaten sind jedoch die Kriterien des aktuellen Junge Ohren Preises, der dieses Jahr für digitale Vermittlungsformate ausgelobt wird (Bewerbungsfrist: 20.05.2021). Unter den Aspekten des Künstlerischen, der Teilhabe, der Innovation und des nachhaltigen Transfers sind statt Beurteilungskriterien Fragen formuliert, anhand derer Musikvermittelnde neue digitale Formate entwickeln oder erfolgte Projekte reflektieren können. So heißt es beispielsweise: „Welches künstlerische Wagnis geht das Projekt durch den Einsatz digitaler Technologien ein?“ oder „Welchen Grad an digitaler Partizipation ermöglicht das Projekt? Wie sind Expert*innenwissen und Anwendungskenntnisse verteilt? (Prinzip der Augenhöhe)“7. Ein nachhaltiger Transfer von musikvermittlerischer Kompetenz betrifft auch die Transformation des Musikbetriebs. Musikvermittler*innen müssen ihre Erfahrungen und Kontakte aus digitalen Formaten in strategische Diskussionen auf Leitungsebene einbringen können. Denn auch bei hauseigenen Transformationsprojekten liegt der Erfolg im Prinzip des Dialogs und der Partizipation: Wer selbst transformieren und nicht transformiert werden will, hört sich um, hört anderen zu und greift neue Ideen auf.
Dieses Vorgehen entspricht der Kernkompetenz von Musikvermittlung. Dabei geht es nicht nur um ein „Vermitteln von“ oder ein „Vermitteln zwischen“ (wie dies u.a. Rebekka Hüttmann8 dargelegt hat), sondern auch um ein „Ermitteln von Musik“ (wie Hans Schneider9 am Beispiel der Neuen Musik aufzeigt).
- Irena Müller-Brozovic, Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich (Linz) und Hochschule für Musik FHNW in Basel
- Hans Georg Nicklaus, Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich (Linz) und Musikredaktion Radio Ö1/ORF
Anmerkungen
1 Die Aktualität dieses gesellschaftspolitischen Ideals belegt das Handbuch zu Kultureller Teilhabe des Schweizerischen Bundesamts für Kultur: „Kulturelle Teilhabe stärkt das Zusammenleben und den Zusammenhalt in einer vielfältigen und individualisierten Gesellschaft. Deshalb sollen alle Menschen Zugang zum Kulturleben und zum kulturellen Erbe haben.“ Nationaler Kulturdialog (2019): Kulturelle Teilhabe. Ein Handbuch, S. 5; https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57315.pdf
2 Zu den unterschiedlichen Beteiligungsgraden von Kulturvermittlung vgl. Carmen Mörsch; https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=4&m2=5&la…
3 https://oe1.orf.at/artikel/329233/WAGner-DICH
4 Wie klingt Freude? https://oe1.orf.at/collection/668248
5 Christian Mikunda: Der verbotene Ort oder Die inszenierte Verführung. München , 2. Aufl. 2005, S. 13–25.
6 Franziska Spohr: Warum eine Theorie zu „Partizipativem Musiktheater“? Diskurs und Hintergrund. In: Kunstlabore, https://kunstlabore.de/wp-content/uploads/2019/01/4.1-Theorie-des-Parti…
7 https://www.jungeohrenpreis.de/wp-content/uploads/JOP15_Ausschreibung_w…
8 Rebekka Hüttmann: Wege der Vermittlung von Musik, Augsburg 2009
9 Hans Schneider: musizieraktionen frei streng lose, Büdingen 2017