Barbara Vinken: Diva. Eine etwas andere Opernverführerin, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2023, 432 S., € 30,00, ISBN 978-3-608-98456-9
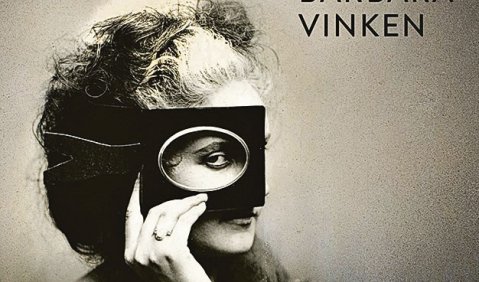
Barbara Vinken: Diva. Eine etwas andere Opernverführerin, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2023, 432 S., € 30,00, ISBN 978-3-608-98456-9
Die Diva ist keine „Opernverführerin“
Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Vinken hat sich an einen Opernführer der ganz eigenen Art gewagt: „Diva. Eine etwas andere Opernverführerin“. Verführen will sie aus einer feministischen Perspektive zu 13 Opern des 19. Jahrhunderts von ausschließlich männlichen Komponisten – Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Bizet, Mascagni, Berg und Richard Strauss – und ihren Librettisten. Dabei wählt sie lediglich populäre Werke aus, die auf Spielplänen am laufenden Band zu finden sind, wie „Le nozze di Figaro“, „Norma“, „La Traviata“, „Carmen“ oder „Der Rosenkavalier“. Vinken sieht die Oper als „raffiniert witzige Reflexion auf Geschlechterkonstellationen“ und als ein Sprengen des heteronormativen Genderkorsetts. Laut der Autorin ist die Oper „ein hochpolitisches subversives Genre, das die angeblich ‚natürlichste‘ aller Oppositionen zersetzt, die aller Politik der Moderne, weil sie Geschlechterpolitik ist, zu Grunde liegt: die Opposition von Männern und Frauen.“ Über Musik spricht Vinken, die sich selbst als „Opernliebhaberin“ beschreibt, dabei so gut wie gar nicht.
Vinken schafft mit ihrer Diva praktisch eine Gegenstimme zu Catherine Cléments Buch „Die Frau in der Oper. Besiegt, verraten und verkauft“, seit dessen Erscheinen 1979 der Oper ihrer Meinung nach Unrecht getan werde. „Die Oper ist nicht rassistisch, homophob oder frauenfeindlich“, lautet Vinkens steile These. Genderfluidität, Non-Binarität und Pansexualität seien in dem Genre schon lange behandelte Themen, mit Trans- und Travestie führe die Oper vor Augen, dass Geschlechterrollen nicht Ausdruck des biologischen Geschlechts seien. Bei näherem Lesen bleiben Vinkens Behauptungen jedoch pauschal und betonen das Aufbrechen von männlichen und weiblichen Rollenbildern durch Verkleidung auf der Bühne, „Hosenrollen“ und Kastratenstimmen, ohne Begriffe wie „pan“ oder „non-binär“ genauer zu differenzieren. So schreibt Vinken: „Auf wen würde das Pansexuelle, Nicht-Binäre besser zutreffen als auf den Cherubino Mozarts oder den Rosenkavalier, engelhafte Jünglinge, noch nicht ganz Mann, die in Frauenkleidern mit ihrem hinreißenden Sopran die Herzen aller verzaubern.“ Der Page Cherubino in Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ beispielsweise verkleidet sich als Frau, um vorgeblich den Grafen Almaviva zu verführen. Dabei vergisst Vinken zu erwähnen, dass eine Verkleidung zunächst weder etwas mit Queerness noch Transvestie zu tun hat, also nicht Ausdruck einer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ist, sondern wie mit Cherubino das Verkleidungstheater lediglich ein Spiel darstellt, in dem sich die Charaktere gegenseitig vorführen. Dazu passend steht die Aussage der Autorin, Cherubino sei doch die weiblichste Figur auf der Bühne, „das schönste aller Mädchen. Binäre Geschlechter werden tatsächlich durchkreuzt.“ All diese Beobachtungen scheinen sich der Autorin allein durch äußere Merkmale wie das Aussehen der Figur zu erschließen, eine differenziertere Analyse von Cherubinos Geschlechtsidentität bleibt aus.
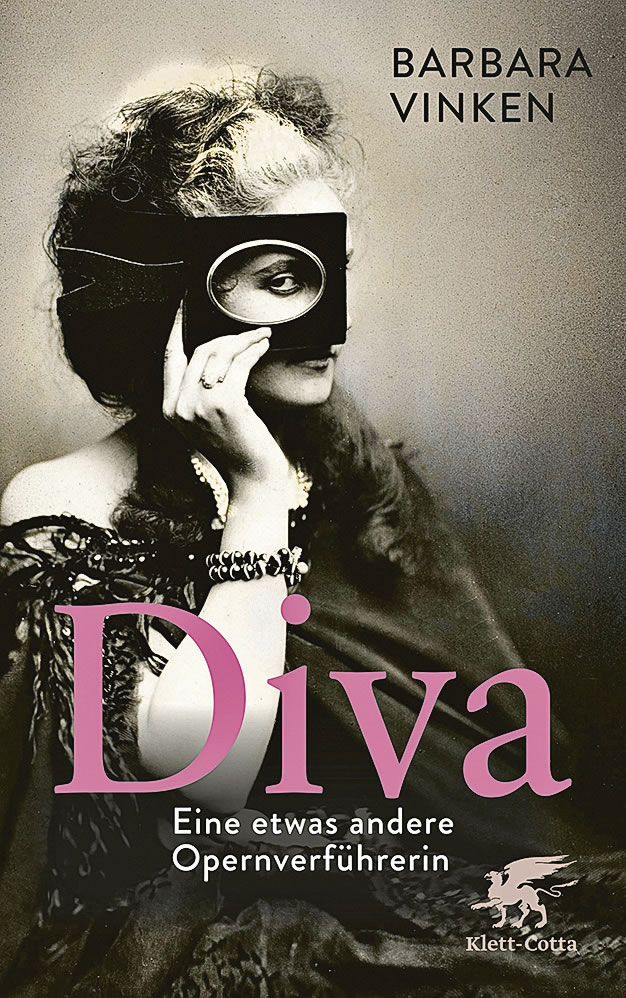
Barbara Vinken: Diva. Eine etwas andere Opernverführerin, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2023, 432 S., € 30,00, ISBN 978-3-608-98456-9
Männer kommen laut Vinken in der Oper ganz schlecht weg: „Die Männer mögen mit dem Leben davonkommen – aber nicht mit viel mehr. Ihr Ruf ist jedenfalls ruiniert. Fast kann man sagen, dass ‚Männlichkeit‘ in der Oper ein Schimpfwort ist.“ Nach Ansicht der Autorin wird Männlichkeit auf der Opernbühne lächerlich gemacht. Sie spricht von emanzipierten Frauenfiguren in der Oper, wobei ihre Argumentation auf der Verkehrung des grausamen Opfertods in der Antike zum christlichen, freiwilligen Heldinnentod und einer Liebe, die sogar den Tod überwindet, basiert. Als Beispiel an vorderster Front nennt Vinken hier Verdis „La Traviata“ und überschreibt das diesbezügliche Kapitel mit dem Titel „Liebe stärker als der Tod“. Vinken findet, die an Schwindsucht sterbende Kurtisane Violetta Valéry sei ein privilegiertes Opfer, da sie sich aus freiem Willen zum Liebesopfer entscheide und dadurch zu Gott finde, während Germont „in die Blindheit der eitlen Leidenschaften der Welt“ gehe – auf diese Art wird die Stärke von Weiblichkeit durch das Herbeiführen eines Märtyrerinnen- Todes von der Autorin romantisiert.
Zudem spricht Vinkens Behauptung, Kastraten stellten die „Ent-Naturalisierung der Geschlechterrolle“ dar, gegen die Entstehung der Kastraten-Rolle, die ursprünglich darauf zurückzuführen ist, dass weiblichen Personen das Mitwirken im Kirchengesang verboten war. Unreflektiert ist außerdem Vinkens Sprache, die manchmal so kunstvoll und verworren ist, dass sie Sachverhalte eher verkompliziert als sie klar verständlich darzustellen. Bedenkenlos verwendet sie diskriminierende Fremdbezeichnungen, was den Eindruck hinterlässt, dass der Autorin das Aufgreifen aktueller Debatten nicht am Herzen liegt. Sie beschränkt sich ferner auf ein wirklich winziges Repertoire und lässt Opern weiblicher Komponistinnen oder moderne Inszenierungen ganz aus. Ist Vinkens „Diva“ eine Verführerin zur Oper? Wohl eher nicht.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!