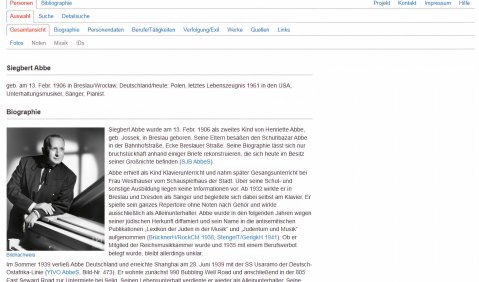Berücksichtigt werden alle Formen des Musikerberufs, von den Bereichen Komposition und Interpretation bis zur Vermittlung, Distribution, Organisation und Verwertung von Musik. Auch die Verfolgungskriterien werden breit ausgelegt, um dem allumfassenden Machtanspruch des NS-Regimes Rechnung zu tragen. So spielte in den meisten Fällen Rassismus als Ursache der Verfolgung eine Rolle, also die Herkunft aus jüdischen oder auch aus Sinti- und Roma- oder Schwarzen Familien. In anderen Fällen betraf die Verfolgung politische Gegner des NS-Staats, etwa Sozialdemokraten oder Kommunisten, Vertreter verbotener Weltanschauungen, etwa Freimaurer oder Anthroposophen, oder homosexuelle Menschen. Außerdem wird die kulturelle Verfolgung einbezogen, das heißt die Diffamierung musikalischen Schaffens als „unerwünscht“, „entartet“, „international“ oder „bolschewistisch“ – so die abwertende Sprache der damaligen Zeit.
Randbereiche
Auch alle Konsequenzen der Verfolgung werden betrachtet, das Exil im Ausland ebenso wie die Deportationen oder das Abtauchen im Versteck. Zudem ergeben sich Fallbeispiele, die eher am Rand stehen, etwa Protestemigranten, innere Emigranten oder Musikamateure, die sich in einer Verfolgungssituation professionalisierten. Auf diese Randbereiche soll nicht verzichtet werden, weil die verschiedenen Möglichkeiten des Überlebens – etwa durch Musik, durch Anpassung, durch Rückzug – gerade die Vielfalt der historischen Realität veranschaulichen. Es geht im LexM also um Lebens- und Berufswege von Musikern und Musikerinnen, die durch das NS-Regime gestört oder gar zerstört, zumindest aber in andere Bahnen gelenkt wurden. Unwiederbringlich verschwanden oder verstreuten sich mit ihnen weltweit vielfältige Ideen der kompositorischen, interpretatorischen, musikpädagogischen, musikwissenschaftlichen und musikverlegerischen Praxis.
Biografische Recherchen
Derzeit umfasst das LexM etwas mehr als 5.600 Personeneinträge. Davon sind knapp 1.000 ausführlich ausgearbeitet, während es sich bei rund 4.600 weiteren um sogenannte Kurzeinträge handelt, die bislang nur Angaben zu Namen, Lebensdaten, Berufen und einschlägigen Quellen enthalten. Die Ausarbeitung dieser Kurzeinträge zu ausführlichen Artikeln erfolgt laufend durch die Projektbeteiligten unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Arbeitsschwerpunkte sowie ergänzend durch einzelne externe Autorinnen und Autoren. Neben der Präsentation bekannter Musikerpersönlichkeiten – von Arnold Schönberg und Lotte Lehmann bis zu Fritzi Massary und Artur Schnabel – werden vor allem zu heute vollkommen vergessenen Musikern und Musikerinnen umfassende biographische Recherchen vorgenommen – beispielsweise Magda Spiegel oder Siegfried Sonnenschein. Dies eröffnet die Möglichkeit, Quellenbestände in Privatbesitz zu entdecken, die von der Forschung bislang nicht beachtet wurden. Das LexM bietet dabei zwei grundlegende Perspektiven. Zum einen gewährt es Einblicke in individuelle Biographien. Neben einem ausformulierten Lebenslauf, in dessen Zentrum die Verfolgungsgeschichte und die Auswirkung auf den Musikerberuf steht, finden sich darin strukturierte Informationen zu den Aspekten Person, Beruf, Verfolgung, Werke und Quellen. Ergänzungen bieten Medien, Links und Identifikationsnummern. Das Lexikon kann auf diese Weise beispielsweise gezielt genutzt werden, um passendes Repertoire für die Aufführung im Konzert zu finden. Zum anderen unterstützt das LexM die wissenschaftliche Arbeit. Insbesondere bildet es die Grundlage für kollektivbiographisch angelegte Forschungsansätze, so wie sie auch in den Teilprojekten des Langzeitvorhabens „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“ vorgesehen sind, beispielsweise zu einzelnen Exilländern und Inhaftierungsorten, Berufsgruppen oder Genres. Solche Ansätze werden durch detaillierte Suchfunktionen ermöglicht, und zwar auf der Grundlage von Freitextsuchen ebenso wie von Schlagwortsuchen, in denen etwa Aspekte wie Geschlecht, Beruf, Verfolgungsgrund und Aspekte von Verfolgung/Exil erfasst werden.
Analyse der Geodaten
Die Daten aus dem LexM bergen aber noch weiteres Potenzial für kollektivbiographische Forschungsansätze. Bislang handelt es sich vorrangig um ein textbasiertes Lexikon. In einem Teilprojekt werden nun aber insbesondere die Geodaten aus den Personenartikeln – beispielsweise Geburtsorte, Sterbeorte, Inhaftierungsorte und Exilländer – sowie weitere Daten analysiert. Diese werden in zeitlichen und weiteren Relationen in Beziehung gesetzt und für die Visualisierung auf Karten und in Diagrammen vorbereitet. Das Ziel besteht darin, ein Instrument zu schaffen, mit dem sich Forschungsergebnisse nicht nur anschaulich darstellen, sondern mit dem sich auch Forschungsfragen neu entwickeln lassen.
Sophie Fetthauer, Leiterin der Hamburger Arbeitsstelle „NS-Verfolgung und Musikgeschichte“