Oliver Vogel: Erik Satie. Der skeptische Klassiker, Metzler/Bärenreiter, Stuttgart/Kassel 2024, XII, 712 S., Abb., € 59,99, ISBN 978-37618-2526-6
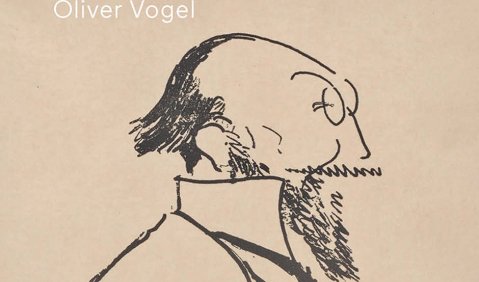
Oliver Vogel: Erik Satie. Der skeptische Klassiker, Metzler/Bärenreiter, Stuttgart/Kassel
Der empfindsame Sonderling
Er gilt als Exot. Bis heute. Dennoch oder gerade deswegen genießt Erik Satie eine außergewöhnliche Popularität. Denn seine Musik ist so eigen, so unverkennbar, dass sie für die Werbung genauso interessant ist wie für den Film. Doch ist das Schaffen des Franzosen ungleich größer, ungleich komplexer, als es zunächst den Anschein hat.
Satie hat sich gerne inszeniert, vor allem als ein Mann der Widersprüche. Er wirkte exzentrisch und verführerisch, aber er konnte in ähnlicher Weise auch verstören. Er gab sich gerne als Bohemien, galt als verschroben, etwa weil er sich tagelang im Spiegel anschauen konnte oder weil er beharrlich mit Hut und Mantel in einem Hotelzimmer sitzen konnte. Er soll sieben Cord-Anzüge auf einen Streich erstanden haben, um in der Öffentlichkeit immer gleich gekleidet zu erscheinen. Satie, das Mirakel.
Erik Satie als Mensch, Musiker und Kunstfigur
Von Satie selbst ist bekenntnishaft überliefert, dass es sich bei seinen Werken „nicht um Musik handelt“. „Ich mache Phonometrie, so gut es eben geht.“ Lakonisch fragt er: „Bin ich denn etwas anderes als ein Akustikarbeiter ohne großes Wissen?“ Oliver Vogel bezeichnet Satie daher in seinem neuen Buch einen „Sokrates der Musik“. Ein Musik-Philosoph also!? „Wo ein Leben als eine Reihe von Seltsamkeiten erzählt wird, darf dem Erzähler misstraut werden. Soll, wovon er redet, die ganze Sache sein?“ Damit ist Vogels Ansatz bereits umrissen: Er möchte Satie, der sich gerne unter seinen Kopfbedeckungen und hinter Brillen und Monokeln zurückgezogen hat, als Menschen und als Musiker unter die Lupe nehmen, ihm sozusagen die Masken entreißen und die von ihm gerne gestreuten „Anekdoten und Phantasien“ hinterfragen: „mit Sinnlichkeit verschleierte er die Sicht auf das möglicherweise Sinnhafte seines Lebens und listig entwand er es zusammen mit seinen Werken dem fertigen Urteil.“
Geboren in der Normandie, aufgewachsen in Paris, ist Satie weitgehend ein Autodidakt, wie man es von einem Sonderling seines Kalibers fast schon erwarten kann. Erst mit fast 40 Jahren will Satie nochmals die Schulbank drücken. Zwar versucht sein Lehrer Albert Roussel, ihm dieses Vorhaben auszureden, doch Satie bleibt beharrlich und möchte Komposition und Kontrapunkt (neu) lernen. Ihm geht es allein um die Sache: „Was manchen Abenteurer in der Mitte des Lebens zu einer Neuorientierung bestimmt, die Sorge, seine Existenz abzusichern, interessierte den bescheiden lebenden Künstler aus Arcueil nicht.“ Nach dreijähriger Studien-Zeit erwirbt Satie sein Diplom.
Dieser biografischen Zäsur entsprechend, gliedert sich sein musikalisches Schaffen, grob gesagt, in zwei Phasen: Jugendwerke, Unterhaltungsstücke für Cafés und andere Vergnügungs-Orte einerseits, und die Früchte aus seiner Zeit als spätberufener Schüler und Absolvent andererseits. Demzufolge muss Satie lange warten, bis etwa seine Orchesterwerke würdigend wahrgenommen werden. Mitverantwortlich dafür ist etwa „Parade“, jenes Ballett, das, in einer Co-Produktion mit Jean Cocteau und Pablo Picasso, bei der Uraufführung mit den berühmten Ballets Russes 1917 einen Skandal auslöst.
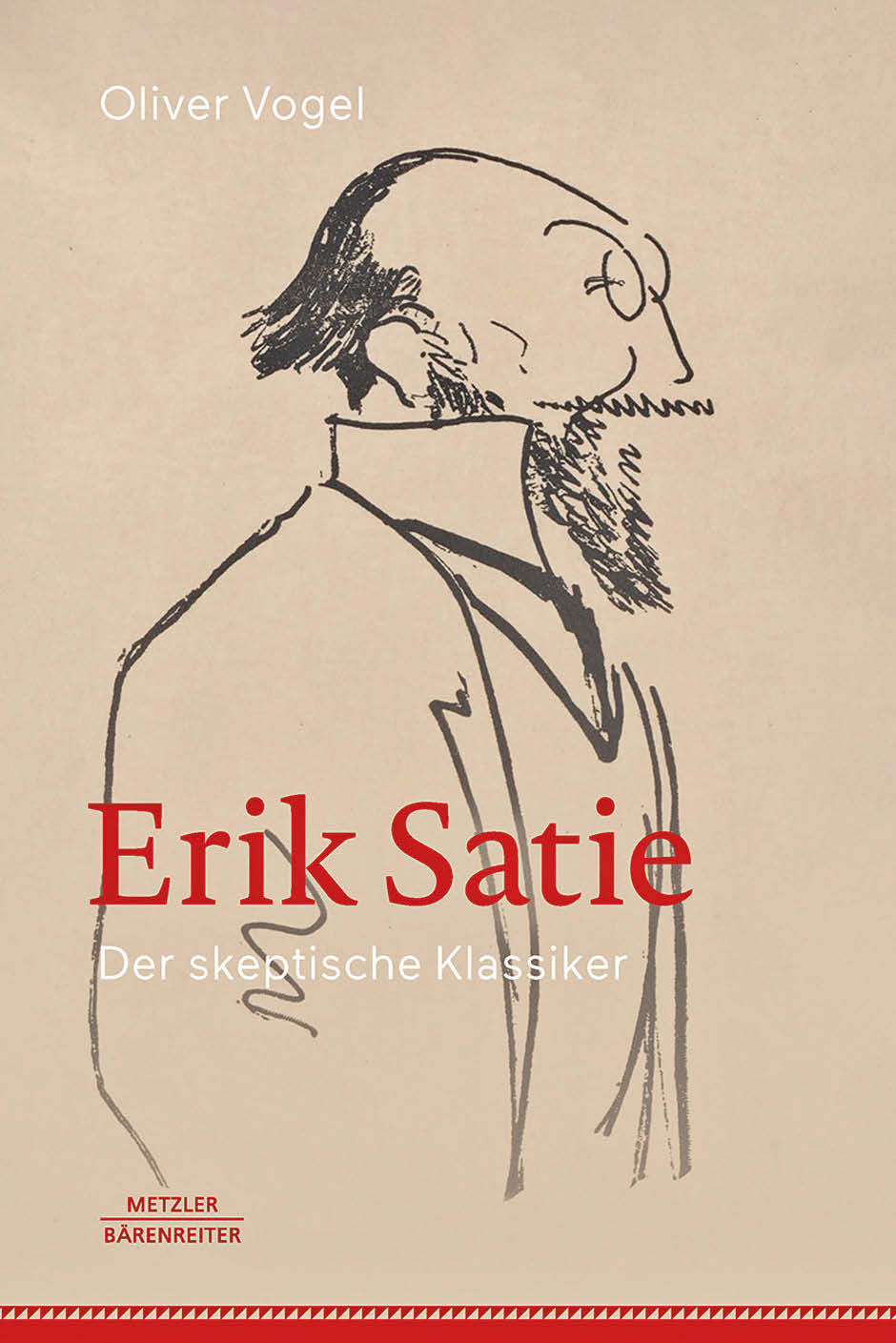
Oliver Vogel: Erik Satie. Der skeptische Klassiker, Metzler/Bärenreiter, Stuttgart/Kassel
Entmystifizierung
Oliver Vogel folgt den zu Beginn seines Buches selbst auferlegten Prämissen gewissenhaft. Er forscht akribisch und widmet den von Satie eigens gestrickten Legenden nur so viel Raum, um sie zu bestätigen oder, und das häufiger, um sie zu entkräften. Er weist nach, dass Satie sich nicht gescheut hat, sich mit den mächtigsten Publizisten seiner Zeit anzulegen, er zeigt aber auch, dass Satie bereitwillig kritische Geister um ihre Meinung gefragt hat, darunter Florent Schmitt und Robert Montfort. Vor allem die sehr detaillierten musikalischen Analysen geben Aufschlüsse über die Kniffe, die Ideen und das handwerkliche Können Saties, etwa wenn Vogel zeigt, wie Satie seine Techniken funktionalisiert: „Nicht wenige der in den Fugen von ‚Im Pferdegewand‘ entwickelten Ideen sieht man in den späteren Werken als charakteristische Stilmittel wiederkehren.“ Vogel nennt Formen der Wiederholung, dazu die „etwas barock anmutenden“ Anläufe und die zahlreichen Registerwechsel sowie eine gewollte Unzuverlässigkeit von Saties Satztechnik: „Dieser wechselt, wo immer der harmonische Wille nach größerer Deutlichkeit verlangt, spontan von der Einstimmigkeit zur Vielstimmigkeit.“
Vogel zeigt, wie sich Satie innerhalb einer kühnen Avantgarde seinen Platz als Solitär erarbeitet und diesen behauptet, er beschreibt, wie sich Satie für seine Eleven einsetzt und Widersacher in die Schranken weist – auch durch die Vorspiegelung falscher Eigenschaften: „Manchem kam es vor, […] als sei seine Empfindlichkeit eine bloße Marotte.“
Dieses Buch verdient ein breiteres Publikum als es zunächst den Anschein haben mag: musikwissenschaftlich Geschulte kommen ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen, die sich rein aus Neugierde und ohne Vorkenntnisse dem Phänomen „Satie“, seiner Person und der Zeit, in der er gelebt hat, nähern wollen. Oliver Vogel wandert geschickt durch die Fülle seiner Quellen, er arbeitet immer wieder den empfindsam-reizbaren Charakter Saties heraus und führt insgesamt souverän durch eine an Pointen nicht gerade arme Biografie. Auch die von vielen Vernebelungen geprägte Rezeption findet eine knappe Würdigung. Rund vierzig Seiten Anhang runden den erhellenden Band ab.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!