Dis|kontinuitäten. Oper und Operngeschichte zwischen Weimarer Republik und früher Bundesrepublik, hrsg. von Tobias Janz/Benedetta Zucconi, Campus Verlag, Weinheim 2025, 346 S., Abb., Notenbsp., € 45,00, ISBN 978-3-593-51879-4
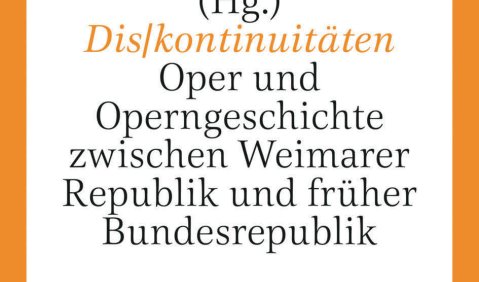
Dis|kontinuitäten. Oper und Operngeschichte zwischen Weimarer Republik und früher Bundesrepublik
Fundgrube zur jüngeren Operngeschichte
Die Oper Bonn hatte zwischen 2021 und 2023 im Rahmen eines Forschungsvorhabens „Fokus ’33“ acht Opern herausgebracht, die in besonderer Weise mit Phasen der deutschen Geschichte verknüpft sind. Das reichte von Giacomo Meyerbeers „Ein Feldlager in Schlesien“ über Richard Strauss’ „Arabella“, Franz Schrekers „Der singende Teufel“ und Rolf Liebermanns „Leonore 40/45“ bis zu Kurt Weills Mahagonny-Oper und am Ende zu Arnold Schönbergs „Moses und Aron“. Verantwortet hatte das Projekt der während der Schönberg-Proben unerwartet verstorbene Dramaturg Andreas Meyer. Zum Gedenken an ihn organisierten Oper und Universität ein Symposion zu Traditionen und Brüchen in der deutschen Operngeschichte, das im vorliegenden Tagungsband dokumentiert ist.
Die vielzitierte „Stunde Null“ hat es zumindest in Musik und Literatur nicht gegeben. Fast waren die Brüche beim Wechsel vom Kaiserreich zur Weimarer Republik gravierender. Der Berner Musikwissenschaftler Anselm Gerhard zeigt das an der Entwicklung der Opernhäuser und Theater: Vor 1918 waren viele Häuser gleichsam privilegiert durch ausreichende fürstliche (freiwillige) Zuwendungen – fast über Nacht sahen sich dann Kommunen mit der Finanzierungsproblematik konfrontiert und anfangs regelrecht überfordert. Gleichzeitig dominierte die Spielpläne das traditionelle Repertoire, angereichert allenfalls durch den Siegeszug des Zeitgenossen Giacomo Puccini.
Wie nach allen politischen Umbrüchen stehen Aufbruch- und Weltuntergangsstimmung dicht beieinander. Schon in der Weimarer Republik war die Krise der Oper ein Dauerthema unter Künstlern und Journalisten. Das setzte sich bald nach 1945 fort und gipfelte in der kessen Forderung des französischen Avantgardisten Pierre Boulez „Sprengt die Opernhäuser in die Luft“.
Bekannt und vergessen
Am Beispiel einzelner Werke zeigt das Buch solche Kontinuitäten und Brüche. Die Oper „Schwanda der Dudelsackpfeier“ des Tschechen Jaromir Weinberger (1896–1967), 1927 in Prag uraufgeführt, wurde zum Renner in ganz Europa, verschwand aber nach 1933 von deutschen Spielplänen und ist seitdem kaum wiederaufgeführt worden. Ihre Verbindung von nationaler Romantik und musikalischer Avantgarde war für das Zeitempfinden geradezu ideal und dann doch schnell überholt. „Der Sturz des Antichrist“ des in Auschwitz ermordeten Victor Ullmann von 1935, erst 1995(!) in Bielefeld uraufgeführt, wird als Beispiel für den Typ Weltanschauungsoper thematisiert, der in seiner religiösen Ausprägung nach 1918 überaus zahlreich war (unter anderem Honeggers „König David“ und „Judith“, Milhauds „Christophe Colomb“, Hindemiths „Mathis der Maler“, Reutters „Saul“). Ein traurig stimmender Text berichtet von den vergeblichen Versuchen Ernst Wolfgang Korngolds, nach dem Krieg in Europa wieder Fuß zu fassen, wofür er eine „atonal-hasserfüllte“ Kritik verantwortlich machte. Seine resignierende Ansicht, er sei vergessen, habe sich, so der Berliner Musikwissenschaftler Arne Stollberg, „in denkbar erfreulicher Weise“ als falsch erwiesen.
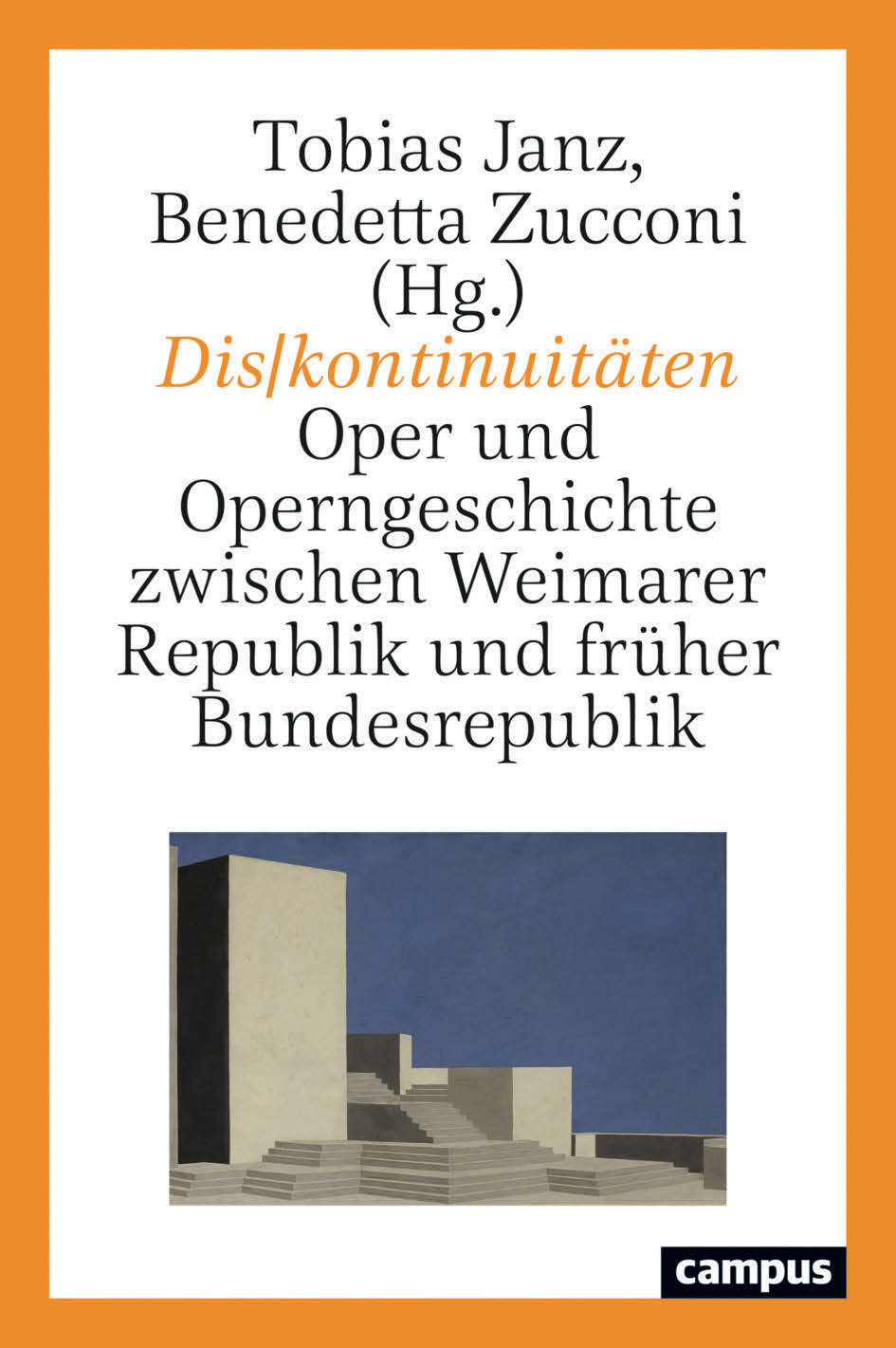
Dis|kontinuitäten. Oper und Operngeschichte zwischen Weimarer Republik und früher Bundesrepublik
1933 bedeutete auch in der Musik einerseits einen Bruch, da jüdische Künstler ihre Arbeit verloren und Werke jüdischer Komponisten kaum noch aufgeführt wurden; andererseits gab es eine Kontinuität zahlreicher Stilelemente, insbesondere bei naturalistischen Darstellungen zeitgenössischer Situationen, als die Zeitoper gleichsam zur Volksoper wurde. Als Beispiele nennt der US-Forscher Max Erwin für erstere Georg Antheils „Transatlantic“, Ernst Kreneks „Der Diktator“ und Max Brands „Maschinist Hopkins“, für erfolgreiche Opern in der NS-Zeit unter anderen Mark Lothars „Lord Spleen“ und Hans Stiebers „Der Eulenspiegel“. Und auch der Jazz, schon in der Weimarer Republik in zahlreichen Opern erfolgreich eingesetzt (Hindemith, Schulhoff, Weill), war nach 1933 keineswegs durchweg verpönt, als ihn Komponisten wie Edmund von Borck, Boris Blacher und Werner Egk produktiv aufgriffen. Mit dem Swing hatte das Regime ohnehin keine grundsätzlichen Probleme, einige solcher Unterhaltungskapellen standen bis 1945 sogar auf Hitlers „Gottbegnadeten-Liste“.
Das Buch, abgerundet mit Aufnahmen aus den genannten Opern der „Fokus ’33“-Reihe, ist eine Fundgrube zu kaum bekanntem Wissen zur Operngeschichte im 20. Jahrhundert. Ganz treffend ist der Untertitel freilich nicht: Der „frühen Bundesrepublik“ wird vergleichsweise wenig Raum eingeräumt, der Schwerpunkt liegt auf der ersten Jahrhunderthälfte. Auch hätten gerade bei Blacher oder Egk Kontinuitäten gezeigt werden können, waren beide doch auch nach 1945 mit neuen Werken erfolgreich. Aber diese Einwände mindern den Wert dieses wichtigen Bandes nicht.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!