Therese Muxeneder: Arnold Schönberg & Karl Kraus, edition text + kritik, München 2024, 320 S., Abb., € 36,00, ISBN 978-3-96707-919-7
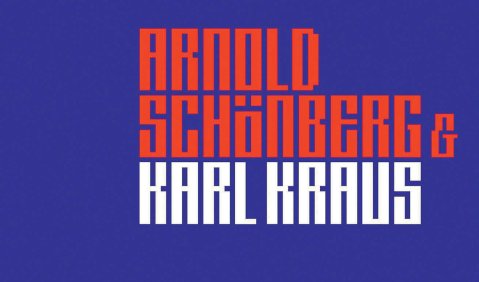
Therese Muxeneder: Arnold Schönberg & Karl Kraus, edition text + kritik, München 2024, 320 S., Abb., € 36,00, ISBN 978-3-96707-919-7
Künstlerfreundschaft mit Widerhaken
„Wien, Wien, nur du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume sein.“ So schmeichelte einst Peter Alexander. Der Wiener „Schmäh“ hat dies treffend konterkariert: „Wien, Wien, nur du allein, gemma, gemma ins Altersheim.“ Ewiges Frühlings-Jauchzen und trübsinnige Morbidezza stehen fast für eine Art DNA der Donau-Kapitale: das In-eins von Aufschwung und Untergang, nicht minder die Janusköpfigkeit von Vergangenheits-Sucht und Fortschritts-Elan, Lokal-Patriotismus und Thomas Bernhardscher „Nestbeschmutzung“.
Flaniert man durch Wien, so ist man zunächst geblendet durch die sowohl spätbarock-absolutistische als auch imperial pompöse Pracht-Architektur der Gründer-Zeit. Doch weniger augenfällig, gleichwohl kaum minder signifikant, ist die Gedenk-Kultur: Allenthalben entdeckt man an den Fassaden Hinweise, wer hier geboren wurde oder starb, wer hier lebte, Großes vollbrachte, erhabene Werke schuf: Künstler aller Art, Literaten, Forscher, Erfinder, Politiker, Militärs – allesamt Größen der Vergangenheit, lastend über der Gegenwart. Geht man gar in die Kapuziner-Gruft, so fühlt man sich vollends im Totenreich. Und keinesfalls zufällig kommt einem „Das Wirtshaus“ der „Winterreise“ in den Sinn: „Sind denn in diesem Hause die Kammern all’ besetzt?... O unbarmherz’ge Schenke, doch weisest du mich ab?“ Unschwer wird evident, warum die Moderne, das lebendig Neue, es in Wien immer schwer hatte.
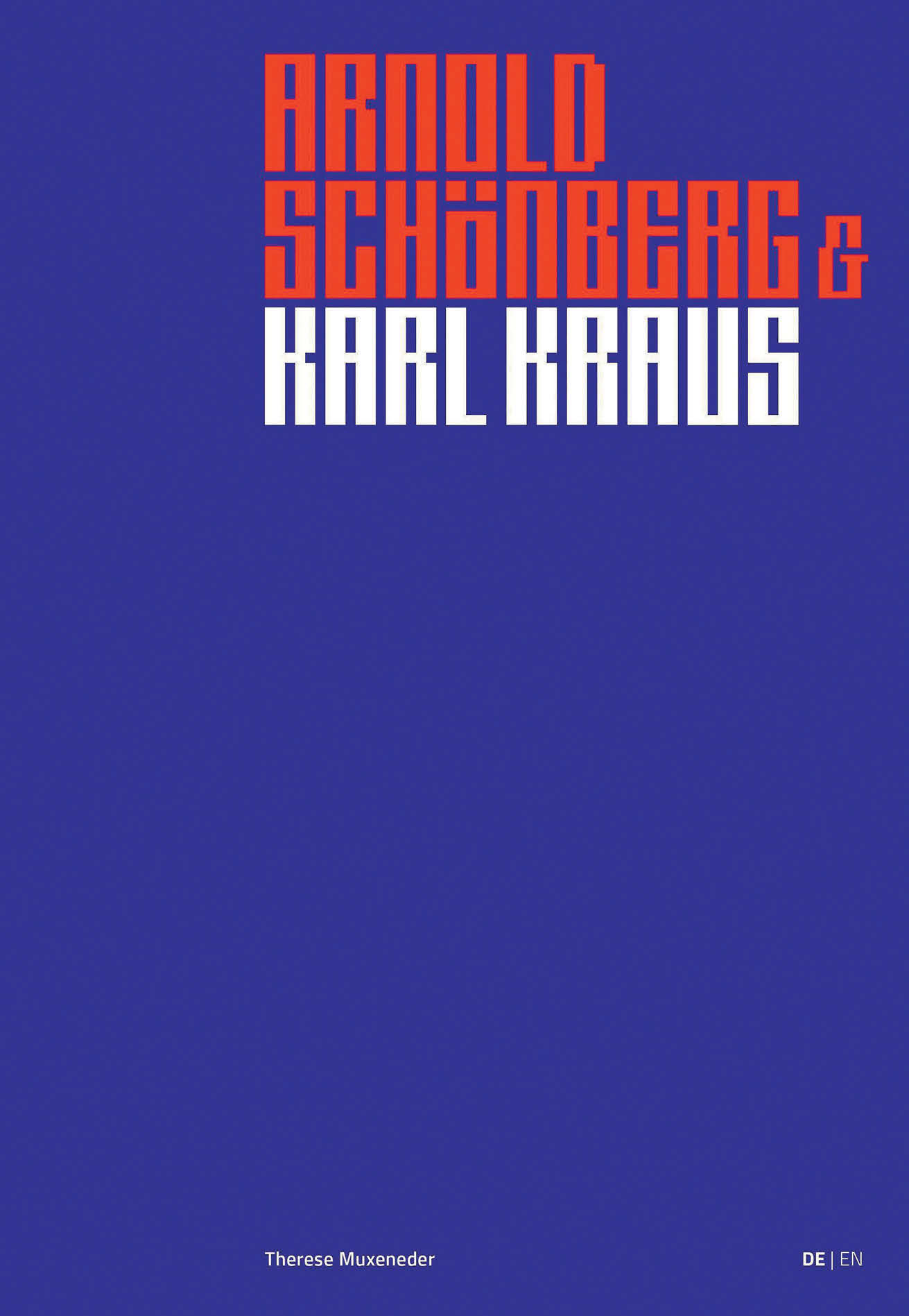
Therese Muxeneder: Arnold Schönberg & Karl Kraus, edition text + kritik, München 2024, 320 S., Abb., € 36,00, ISBN 978-3-96707-919-7
Spezifisch ist indes nicht nur die Verklärung „besserer“ Zeiten: Wien war stets auch Fortschritts-Labor. Ein beliebtes Gesellschaftsspiel war die Aufforderung, Zeit, Raum und Umstände zu nennen, die einem am meisten behagt hätten. Mancher plädierte für Wien im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts: Wer da alles gewirkt habe: Mahler, Freud, die Schönberg-Schule, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Hofmannsthal, Klimt, Schiele, Kokoschka, die Physiker Mach und Schrödinger, der Architekt Adolf Loos, selbst Kafka. Im Habsburger Vielvölker-Staat war Pluralität angesagt, einschließlich der nicht geringen jüdischen Komponente. Und der Vielfalt der Persönlichkeiten entsprach die der Aktivitäten. Denn nicht wenige der Protagonisten waren miteinander bekannt, ja befreundet, wenn nicht sogar verfeindet. Wer Wiener Diskussionen verfolgt hat, weiß, wie nah die Extreme beieinander liegen, verzahnt sind. Mitunter hat Wien etwas von einem multiplen „Gesamtkunstwerk“. Die Wiener Aktionisten verschiedener Art bestätigen dies – auch im In-eins von Ritual und Destruktion.
Beziehungslabyrinth
So verwundert es nicht, dass zwei epochale Figuren gleichermaßen innovativ und provokativ wirkten: Arnold Schönberg und Karl Kraus sind in Personalunion Ton- wie Wort-Künstler, Umstürzler und Bußprediger. Wobei das Schlagwort vom „konservativen Revolutionär“ Schönberg sogar für den grimmigen Satiriker Kraus gilt.
So wie Schönberg mit Abwehr auf seines abtrünnigen Schülers Hanns Eisler kommunistisches Engagement reagierte, so war auch Kraus weder dezidiert „links“ noch ein entschiedener Verfechter radikal moderner Kunst. Das „rote Wien“ bedeutete ihm nicht eben viel, ebenso wenig die sozialistische Internationale oder die junge Sowjetunion. Die Freudsche Psychoanalyse schmähte er als die Krankheit, die zu heilen sie vorgäbe. Mit großem Ernst wandte er sich gegen die Geringschätzung Mahlers wie Schönbergs oder des Architekten Loos. Dies entsprang weniger einem besonderen ästhetischen Rigorismus und mehr der Empörung über die unsäglich perfiden reaktionären Machenschaften des Wiener Feuilletons. Als Polemiker und greller Satiriker bleibt er ein über Epochen gültiges Vorbild. Vor allem im in der Sprache erschütternd manifesten Grauen des Ersten Weltkriegs („Das Ende der Menschheit“). Sein Furor in der Demaskierung der journalistischen Phraseologie bleibt singulär, auch in der Attacke gegen den Salzburger „Jedermann“.
Elementar freilich war stets seine Aversion gegen die vor allem Wiener Journalisten und dies sicher nicht ohne Grund. Spielte doch die sachliche Auseinandersetzung eine weit geringere Rolle als die Intrige oder Häme gegen Schönberg, der unter dem Ressentiment litt, zugleich aber die antisemitische Ranküne spürte, die wiederum selbst bei Kraus’ Heine-Polemik mitschwang. Ein musikalisch ebenbürtiger Gesprächspartner war Kraus für Schönberg nicht.
Die Beziehungen zwischen Kraus und Schönberg waren außerordentlich komplex, zumal im Wiener Geflecht des ersten Jahrhundert-Drittels. Therese Muxeneder hat dieses Labyrinth bewunderungswürdig umfassend und perspektivenreich quasi als Parallel-Montage des Wien-Kosmos dargestellt.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!