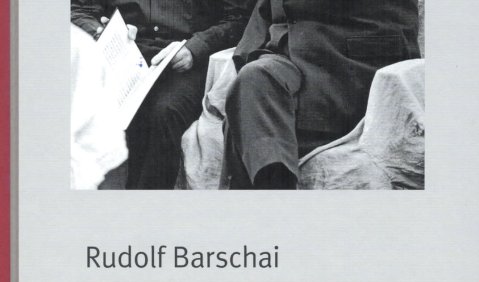Rudolf Barschai dürfte die Gemüter bis heute entzweien: Die Einen haben ihn als diktatorischen Pultstar in Erinnerung, andere verehren ihn anhaltend als genialen Altmeister der russischen Schule. Wer ihn noch persönlich erlebt hat, mag sowohl diese als auch jene Eindrücke von ihm bestätigt bekommen und bewahrt haben. Wer ihn nur von den überlieferten Aufnahmen kennt, erhebt ihn womöglich rasch in den unantastbaren Maestro-Himmel.
Der Musikwissenschaftler Bernd Feuchtner, ein Kenner der sowjetrussischen Musikermaterie (wie er nicht zuletzt mit seiner fulminanten Schostakowitsch-Biografie bewies), hat nun den Versuch unternommen, Licht in die teils doch recht verklärte Ikonografie des 1924 in der südrussischen Region Krasnodar geborenen Barschai zu bringen. Dessen Name ist und bleibt eng mit dem legendären Borodin-Quartett verbunden, dem er als Gründungsmitglied von 1945 bis 1953 angehörte. Nicht minder steht Barschai für das Moskauer Kammerorchester, das er 1955 ins Leben rief und bis zu seinem Weggang nach Israel geleitet hatte. Barschai ist aber ebenso als Schostakowitsch-Schüler und Transkribent von dessen Kammermusik unvergesslich geblieben. Allem voran steht beispielhaft die auf dem 8. Streichquartett fußende Kammersinfonie, die vom Meister umgehend autorisiert wurde und als Opus 110a Aufnahme in Schostakowitschs Werkkatalog gefunden hat. Dass er darüber hinaus auch reichlich Musik von Sergej Prokofjew aufgeführt und orchestriert hat, ist heute kaum noch einem großen Publikum bekannt. Für die meisten steht er als Interpret – Barschai war Geiger, Bratschist und vor allem Dirigent – in einer Reihe neben David Oistrach, Swjatoslaw Richter und Mstislaw Rostropowitsch.
Jenseits solch oberflächlich biografischer Fakten lässt Feuchtner tiefer ins Leben dieser 2010 verstorbenen Legende blicken. Er beleuchtet familiäre Hintergründe, die im Sowjetsystem immer auch gesellschaftliche Hintergründe gewesen sind. Erstaunliche Hürden hatte Barschai – wie viele seiner Zeitgenossen auch – wegen „Punkt 5“ in diversen Aufnahmeanträgen zu überwinden. Hinter diesem Punkt stand die Frage nach der Nationalität, in Barschais Fall war sie jüdisch und wurde von Kulturbürokraten nicht gelitten.
Unter antisemitischen Beschimpfungen und Beleidigungen litt Barschai bereits im Knabenalter. Diese Zeit erlebte er als ständige Flucht, die er mit seinem späteren Unterwegssein fortsetzte, wenn auch unter anderen Bedingungen. Die Auswanderung in den 1970er Jahren erscheint, allen musikalischen Erfolgen zum Trotz, geradezu zwangsläufig. Dass seine Frau erst Monate später und nur aufgrund der Interventionen von Golda Meir und Willy Brandt nachkommen durfte, ist ein pikantes Detail.
Bernd Feuchtner hat dieses Buch auf der Basis von Gesprächen mit Barschai in der Ich-Form verfasst. Das schafft eine gesunde Distanz und erklärt wohl auch so manchen thematischen Sprung. Ob Autor oder Stichwortgeber auf familiäre Nebensächlichkeiten nicht verzichten wollten, die dann aber mit einem „dies nur am Rande“ abgetan werden, sei dahingestellt. Dass künstlerische Begegnungen jedoch weit mehr als ein Aufzählen bedeutender Namen sind, versteht sich von selbst. Damit schmücken Barschai und Feuchtner die Erzählstränge nicht aus. Sie berichten von einem Leben, das aus mindestens zwei großen Karrieren bestand und in Kriegszeiten bereits höchsten Gefährdungen ausgesetzt war. Zusammen mit anderen Musikern war Rudolf Barschai zur Truppenbetreuung an die Front geschickt worden, wo er mehrfach in brenzlige Situationen geriet. Viel Aufhebens wird darum nicht gemacht, beim Lesen schwingt aber immer die bange Frage mit, was wäre, wenn …?
Nun, glücklicherweise kam es anders. Barschai erfuhr eine erstklassige Ausbildung, stand mit seinem Kammerorchester als Synonym für qualitativ höchste Musikalität, startete im Westen noch einmal völlig neu durch, genoss seine spätere Wahlheimat in der Schweiz und eroberte sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch das frühere Publikum in Russland zurück. Dass sein Biograf ihn bei der ersten Reise dorthin begleiten konnte, dürfte ein Glücksfall gewesen sein. Wenngleich aus dieser Nähe vielleicht einige Detailverliebtheit resultiert, die bei der Lektüre strapaziös erscheinen mag; für die Nachwelt sind oft auch gerade diese vermeintlichen Kleinigkeiten bewahrenswert.
Nicht zuletzt das Wissen darum sollte die Gemüter wieder vereinen.
- Rudolf Barschai: Leben in zwei Welten. Moskaus goldene Ära und Emigration in den Westen, aufgezeichnet und hrsg. von Bernd Feuchtner. Wolke Verlag, Hofheim 2015, 274 S., Abb., € 29,00, ISBN 978-3-95593-066-0