Jörn Peter Hiekel: Helmut Lachenmann und seine Zeit, Laaber Verlag, Lilienthal 2023, 547 S., Abb., Notenbsp.,€ 46,80, ISBN 978-3-89007-809-0
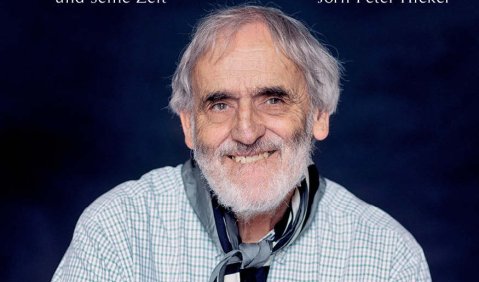
Jörn Peter Hiekel: Helmut Lachenmann und seine Zeit, Laaber Verlag
Vom Geistigen in leibhaftiger Kunst
„Große Komponisten und ihre Zeit“ heißt eine imponierende Reihe von mittlerweile vierundvierzig Bänden im Laaber Verlag – Pendant allenfalls zur Serie der „Musik-Konzepte“. Allerdings geht es bei dem Laaber-Projekt bislang nur um „Komponisten“, nicht auch um Komponistinnen. Wobei der Zusatz „und ihre Zeit“ auf den epochalen Rang, quasi historische Dignität verweist. Dementsprechend waren Hans Werner Henze und Bernd Alois Zimmermann die „jüngsten“ Komponisten – gemäß dem obligaten Wiener Credo „Nur ein toter Künstler ist ein guter Künstler“. Wenn nun der jüngste Band „Helmut Lachenmann und seine Zeit“ heißt, so gilt dies nicht nur einem lebenden Komponisten, sondern sogar einem mit übergreifenden, gar historischen Kategorien kaum zu fassenden Solitär.
Ebendies zeichnet das Buch aus: Jörn Peter Hiekels Lachenmann-Monographie nimmt den Komponisten ernst, indem es dem Leser den Umgang mit ihm ebenso wenig leicht macht, wie dem Hörer – und belegt damit die These, dass Werk und Reflexion darüber einander entsprechen sollten.
Lachenmann ist gewiss nicht der erste Komponist seit Schumann und Wagner, der sich gleichermaßen in Klang wie Schrift manifestierte. Aber Text und Musik gehören seit „Klangtypen der Neuen Musik“ als quasi mäandernde Wechsel-Kommentare zusammen. Den Gefallen, das eine durch das andere verständlicher zu machen, tun uns Lachenmann/Hiekel nicht. Das hängt auch mit Lachenmanns Skepsis gegenüber semantischer Eindeutigkeit zusammen, etwa psychologisierender Emotionalität. Er hält es eher mit Jankélévitchs Idee eines „ausdruckslosen espressivo“. „temA“ für Flöte, Stimme und Cello (1968) verweist denn auch eher auf Weberns Luzidität als auf expressionistischen Aufruhr. Und selbst „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ verharrt eher „im Eisigen“, statt zu larmoyanter Identifikation einzuladen.
Nichts läge Lachenmann ferner als wohlfeiles l’art pour l’art oder gar postmodern schnödes „anything goes“. Entschieden näher ist ihm Eduard Hanslicks Idee von Musik als „Arbeit des Geistes in geistfähigem Material“ – bis hin zu vorsichtigen Überlegungen zur „Transzendenz“. Hiekels Buch stellt hohe Ansprüche, setzt Lachenmann-Hörerfahrungen, Partitur-Einblicke und Textkenntnis voraus. Darin ist es zwar mehr als Monographie, gleichwohl weitgehend auf Lachenmann fokussiert, darin leicht monoperspektivisch gegenüber anderen Positionen. Dass Lachenmanns Beziehung zu Nono elementar war, ist evident, Brüche eingeschlossen. Doch die kompositorischen Strategien divergierten: Elektronik, Bühne, Raumklang, Mikro-Intervallik, nicht zuletzt dezidiert linke Parteilichkeit waren Lachenmanns Sache weniger. Seine Radikalität richtete sich stärker auf die gesellschaftlichen Deformationen noch im wohllautsüchtigen Umgang mit Musik. Doch manche Skandale um ihn zeugten von nicht nur ästhetischer Brisanz. Lachenmann und Wolfgang Rihm haben sich mehrfach ihrer fast brüderlichen Einigkeit versichert. Aber Rihms Neigung zur Bühne, zum identifikatorischen Auskomponieren gewichtiger Texte und zur großen, ausdrucksgesättigten Gebärde geht in Richtung Opern-Opulenz. Einig indes scheinen sich beide in der vorsichtigen Distanz zu Mahler bei gleichzeitig wachsender Neigung zu Strauss, von dem Lachenmann bekannte: er habe, ihn vorwegnehmend, nicht für, sondern „das“ Orchester komponiert.

Jörn Peter Hiekel: Helmut Lachenmann und seine Zeit, Laaber Verlag
Natürlich ist Lachenmann zu allem Überfluss als „Linker“ gescholten worden, doch zum Partei-Dogmatiker taugte er ohnehin nicht. Selbst zum ikonischen Hanns Eisler wahrte er Distanz. Einen kleinen Reflex allerdings gab es doch, zumindest im späten „Got Lost“ für Sopran und Klavier – rar genug, kommen einem immerhin Genre-Assoziationen an Eislers „Zeitungsausschnitte“.
Auf jeden Fall ist Helmut Lachenmann eine alles andere als monolithische Figur, mag er auch manch anderen, durchaus unterschiedlichen Komponisten (Goebbels, Trojahn) schier als „Dinosaurier“ vorkommen – was ja auch von, obschon ambivalenter Verehrung zeugen kann. Nach dem durchaus spektakulären Stuttgarter Konflikt zwischen Lachenmann und Henze schien es, als seien weitere Kontakte ausgeschlossen. Dabei hat Lachenmann Henze noch kurz vor dessen Tod in Italien besucht, wohin es beide – auch als Abwehr der „Wirtschaftswunder“-BRD – zog. Die vielfach multiple Ästhetik Berios, Ligetis und Kagels musste ihm missfallen. Später hat er doch gemeinsame Strategien eingeräumt. Selbstverständlich waren ihm deren, aber auch Schnebels, sogar Stockhausens theatralische bis surrealistische Aspekte suspekt. Dabei war Lachenmann, nicht zuletzt via Adorno, von Mahlers Doppeldeutigkeiten, Schock-Momenten fasziniert. Adornos Einfluss, für unzählige seiner Generation prägend, minderte sich später: Das dialektische Durchdenken bis in die Negativität hinein schien ihm nicht mehr allein verpflichtend; radikal anarchische Geräusch-Klang-Emanationen wurden wichtiger, wie sie Reinhard Meyer-Kalkus im Ineins von Sprach-Motorik und organischer Körperlichkeit exemplifiziert hat.
Hiekel scheut nicht die Mühe des Begriffs, lässt sich auf Lachenmanns hochkomplexes Denken ein. Aber er macht ihn nicht zum einsamen Denker, gar weltentrücktem Guru. Geist und tönende Materie gehören zusammen. Das Ohr ist Medium der Magie.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!