Andreas Domann: Timor et tremor. Angst in der Musik der Frühen Neuzeit (Archiv für Musikwissenschaft – Beihefte, Bd. 93), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, 358 S., Notenbsp., € 70,00, ISBN 978-3-515-13928-1
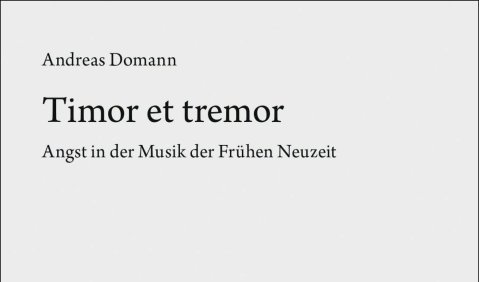
Andreas Domann: Timor et tremor. Angst in der Musik der Frühen Neuzeit (Archiv für Musikwissenschaft – Beihefte, Bd. 93), Franz Steiner Verlag
Wie kurtz diß Leben wehren kann…
Der große Königsberger Lyriker Simon Dach schrieb in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein Gedicht auf die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins, das von dem Komponisten Heinrich Müller in seiner „Geistlichen Seelenmusik“ vertont wurde. Eine Strophe behandelt das menschliche Leben als ein Dasein in Furcht und Angst:
„Wie kurtz diß Leben wehren kann / so ist es dennoch umb und an / nur Arbeit, Angst und Leiden: / Angst ist, was uns zur Welt gebiert / Angst, was uns leitet, trägt und führt / Angst, was uns heisset scheiden.“ – Andreas Domann hat dieses Gedicht und Lied neben vielen anderen Zeugnissen als beispielhaften Ausdruck für Furcht, Angst und Schrecken gewählt, wie sie in zahllosen musikalischen Quellen für eine heute kaum noch vorstellbare Mentalität der Menschen in der Frühen Neuzeit stehen. Das gesungene Lied konnte einen an sich schon drastischen Text entweder verstärken, sofern er Ängste und Schrecken thematisierte, oder Hoffnungen wecken bei Aussicht auf ein ewiges Leben.
Die materialreiche Studie ist Domanns leicht gekürzte Habilitationsschrift von 2023 an der Universität Köln. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich vom Augsburger Religionsfrieden von 1550 bis wenige Jahrzehnte nach dem Westfälischen Frieden von 1648. Es sind „ergiebige“ Jahre, denn wie viele Zeugnisse aus Dichtung und Musik zeigen, prägten diese Zeit die drei sogenannten „Landplagen“ Krieg, Pest und Hunger, wozu, kaum weniger traumatisch, Feuer und Teuerung traten.
Zudem konfrontierten die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges die Menschen häufig ganz unmittelbar mit Verelendung, Mord und Tod. Deutschland, so schätzt man heute, verlor durch diesen Krieg über 50 Prozent seiner Bewohner, manche Regionen wurden zu zwei Dritteln entvölkert. Domann beschreibt nicht unmittelbar die Reaktionen der Menschen, sondern fragt, wie sich deren Ängste in Texten und Liedern niedergeschlagen haben, also in Vokalwerken, Liedern nach Gelegenheitsgedichten, kirchlichen und geistlichen Liedern sowie Liedflugschriften, die, ob nun drastisch und bedrohlich, erbaulich oder tröstlich, reißenden Absatz fanden. Die Titel dieser Sammlungen und Flugschriften sprechen für sich: „Musicalische Friedens-Seuffzer“ von Johann Erasmus Kindermann (1642), „Magdeburgisch Klaglied von der elenden Zerstörung so den 10. Maii des 1631“ von Gregorius Ritzsch, „Krieges-Angst-Seuffzer“ von Johann Hildebrand (1645), „Grausame Beschreibung Der Hölle Und der Höllischen Qual“ von Justus Georg Schottelius (1676); „Geistliche Poemata“ von Martin Opitz (1638).
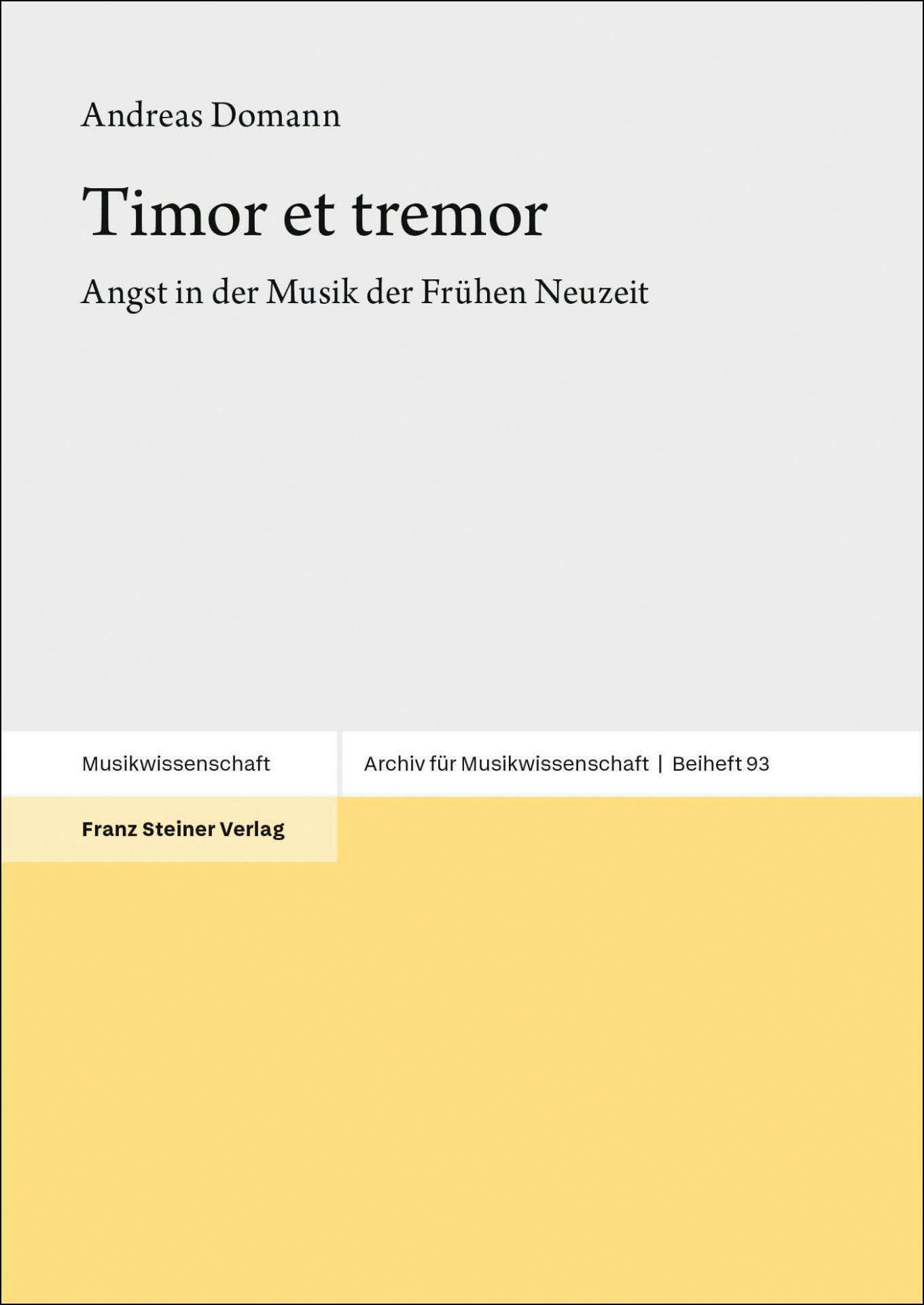
Andreas Domann: Timor et tremor. Angst in der Musik der Frühen Neuzeit (Archiv für Musikwissenschaft – Beihefte, Bd. 93), Franz Steiner Verlag
Fast größer noch war offenbar die Furcht vor göttlichen Strafen und ewiger Verdammnis; jedenfalls lassen die vom Autor herangezogenen Zeugnisse diesen Schluss zu. Es war die Angst vor der Unentrinnbarkeit des göttlichen Gerichts, vor göttlichen Strafen und vor der, wie Domann schreibt, „Ewigkeit des postmortalen Strafvollzuges, sofern er nicht aufgrund mildernder Umstände lediglich im Fegefeuer vollstreckt wurde“.
Alle damaligen Komponisten widmeten sich diesem Genre, Orlando di Lasso ebenso wie Heinrich Schütz, Johann Crüger und Andreas Hammerschmidt (der gegenwärtig eine kleine Renaissance erlebt), Heinrich Albert und Johann Hildebrand; bei den Poeten neben Simon Dach der vom Kaiser zum „Pfalzgrafen“ ernannte Johann Rist, ferner Nikolaus Hermann, Bartholomäus Ringwald und natürlich Paul Gerhardt. Generell sollten alle Lieder zur Umkehr mahnen, zu einem gottgefälligen, tugendhaften Lebenswandel. Und so stehen neben den Höllenliedern auch die Himmelslieder.
Der Autor greift weit über das rein Musikalische hinaus und bezieht Themen aus der Soziologie, der Sozialgeschichte, auch der Theologie und Germanistik mit ein, etwa wenn er beim Gewaltbegriff auf Johan Galtungs Konzept der „strukturellen Gewalt“ zurückgreift oder aus der Sozialgeschichte die „Selbstthematisierung“ erörtert, also die Frage, ob man von einem „Ich“ im heutigen Sinne erst ab der Aufklärung sprechen könne oder schon früher. Domann neigt zur letzteren Auffassung, der man als Leser gut folgen kann; die vielen in der Ich-Form gehaltenen Texte und Lieder spiegeln doch die unmittelbare Betroffenheit wider, wofür herausragend Paul Gerhardt steht. Sein gerade im Protestantismus zum Kanon gewordenes Werk hat auch der Autor immer wieder herangezogen.
Wie von einer Habilitationsschrift zu erwarten, ist die Studie von klarer Analyse und größtmöglicher Nüchternheit geprägt. Mitunter fragt man sich allerdings, ob sich der Autor nicht doch einen etwas emotionaleren Zugang hätte leisten können, spiegeln doch viele der Texte und Lieder in bewegender Weise den grausamen Alltag mit Krieg und Massensterben durch Pest und Hunger und die Angst vor göttlicher Verdammnis wider. Noch heute findet sich diese im Evangelischen Gesangbuch mit Johann Rists aufrüttelndem Schreckenslied „O Ewigkeit du Donnerwort“.
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!