Lange Jahrzehnte war Dmitri Schostakowitsch im Westen ebenso umstritten wie er in der Sowjetunion glorifiziert wurde. Im Westen sahen ihn viele als regimetreuen Repräsentanten der Hauptbedrohung der sogenannten freien Welt, während allerdings die Freidenker unter seinen Landsleuten sich wohl im klaren waren, dass seine Musik hinter der grellen Fassade des offiziellen Scheins auch all das in sich trug, was wir als kollektives ‚Gewissen‘ bezeichnen können.
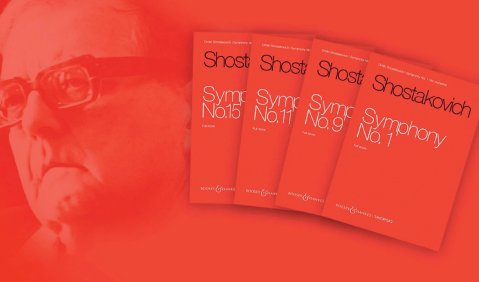
Die Symphonien sind einzeln als Studienausgaben bei Boosey & Hawkes erschienen
Vermächtnis aus der inneren Emigration
Schostakowitsch ist aus heutiger Sicht die herausragende Symbolfigur unter allen Komponisten der ‚inneren Emigration‘. Vieles, was mit den nachweislich opponierenden Mitteln der Sprache in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden konnte, hat er in Musik zum Ausdruck gebracht. Allerdings hat die dreist gefälschte Biographie Solomon Volkovs („Zeugenaussage“) hier für eine scheinbare Eindeutigkeit gesorgt, wie es sie nie gegeben hat, und Schostakowitsch hat die gegenständliche Dimension seines Dissidententums zum Schutz seiner Familie mit ins Grab genommen.
Da er der seit Gustav Mahler erfolgreichste Symphoniker der Geschichte ist – und der mit Abstand meistgespielte und -aufgenommene des 20. Jahrhunderts –, kommt der aufgrund der Erfahrungen in der Praxis korrigierten Neuedition seiner 15 Symphonien auf der Grundlage sowohl der sowjetischen Werkausgabe als auch der hochpreisigen Gesamtausgabe (die dazu ausleihbaren Aufführungsmaterialien sind identisch mit letzterer) in seinem 50. Todesjahr besonderes Gewicht zu. Von Verlagsseite ist dieses Unternehmen einer komfortablen Paperback-Studienausgabe zu erschwinglichem Preis im A4-Format in Anbetracht der Fusion der zwei internationalen Hauptvertreter Schostakowitschs Boosey & Hawkes und Sikorski ein repräsentativ lohnendes Unterfangen. Die Einheitsfarbe Rot hat Symbolwert beim führenden Komponisten der kommunistischen Welt, dessen Schaffensqualität allerdings so universell ist, dass sie selbst den vorauseilenden Boykott vieler westlicher Institutionen gegen Erzeugnisse russischer Provenienz fast komplett unbeeinträchtigt überstanden hat. Lediglich in den baltischen Staaten, Polen und der Ukraine sind Aufführungen seiner Werke seit Februar 2022 signifikant zurückgegangen.
So häufig der Großteil von Schostakowitschs Symphonien heute in den Konzertsälen weltweit regelmäßig zu hören ist, und obwohl inzwischen eine opulente Fülle an Gesamtaufnahmen dieser Symphonien produziert wurde, finden sich darunter doch zwei Werke, die fast nie gespielt werden: die 1927 und 1929 komponierten, einsätzigen Symphonien Nr. 2 und 3, beide weitgehend instrumental und mit einem kurzen Chorfinale, und beide so unterschiedlich, wie sie nur sein könnten. War die erste Symphonie des Neunzehnjährigen noch ein frappanter Geniestreich von unerhört universeller Visionskraft, die die handwerkliche Vollendung überstrahlt, so war die Zweite ein radikales Experiment, dessen Kühnheit an die ersten Meisterwerke seines genialen Zeitgenossen Gavriil (Gabriel) Popov (1904–72) denken lässt (es ist mehr als überfällig, dass man ihn endlich auch entdeckt). In Schostakowitschs Dritter hingegen ist der musikantisch karikierende Übermut, der später in Filmmusik-Partituren wie „The Gadfly“ oder seiner letzten Symphonie so unwiderstehlich verblüfft, schon in voller Kapriziosität entfaltet: ein Alleskönner schüttelt alles in Vollendung aus dem Ärmel.
Die Vierte, seine komplexeste und innerlich zerrissenste Symphonie, wirkt wie eine dynamitgeladene Übersteigerung Gustav Mahler’scher Schreckensvisionen und mündet in eine dunkel verglimmenden Coda, die einen nicht mehr loslässt – zu ihrer Zeit konnte dieses Ungetüm gar nicht aufgeführt werden, so sehr spiegelten sich darin die Greuel der Zeit. Der erste und langsame Satz der Fünften zählen zum Großartigsten, was Schostakowitsch geschaffen hat. Leider hält das Finale diese Höhe nicht, zumal bombastisch präsentierter Sarkasmus sich nicht ohne intellektuellen Durchblick offenbart. In der dreisätzigen Sechsten, die wiederum einen herrlichen langsamen Kopfsatz durchführt, könnte man glatt meinen, der Komponist habe vergessen, ein Finale zu schreiben. Die Siebte, geschrieben während der deutschen Belagerung im ausgehungerten Leningrad, ist von geradezu physisch unwiderstehlichem Effekt, der in guten Aufführungen sogar die immense Länge rechtfertigt und den Weg zu ihren revolutionär-programmatischen Nachfolgerinnen Nr. 11 und 12 (letztere meines Erachtens allerdings allzu langatmig und eintönig) weist.
In den Symphonien Nr. 8 und 10 findet Schostakowitsch zu jener tragisch-monumentalen Ausgewogenheit, die in der Fünften aufgrund ihres polternden Finales ein bisschen ramponiert geblieben war. Hier, wie auch in der bewusst unpompösen und aufs rein musikalische Spiel reduzierten Neunten, hat Schostakowitsch sich als Symphoniker auf voller Höhe befunden. Die Dreizehnte, inopportunes Gedenkwerk für die Opfer des Babi-Yar-Massakers, bezieht erstmal wieder die menschliche Stimme ein – mit Bass-Solo und Männerchor spielt sich alles in der Tiefe, nahe den Dimensionen der unterdrückten Trauer in unserem Unterbewusstsein ab. Die 14. Symphonie dann, Benjamin Britten gewidmet und von Mussorgskys „Liedern und Tänzen des Todes“ angeregt, die Schostakowitsch zuvor orchestriert hatte, reduziert sich auf einen motivisch beziehungsreich verbundenen Zyklus von elf Liedern (Lorca, Apollinaire, Rilke), eingerichtet für Sopran, Bariton und Kammerorchester. Im Grunde dürfte angesichts dieser Erweiterung der Gattung auch die ganz späte „Suite“ von Michelangelo-Liedern (1974) als „Symphonie“ durchgehen – sie würde als 16. Symphonie jedenfalls viel häufiger aufgeführt als in ihrer offensichtlichen Außenseiterrolle.
Die 15. Symphonie entstand 1971, und in ihr zieht Schostakowitsch noch einmal rein instrumental alle Register seines symphonischen Ausnahmeranges, unter Einbeziehung heterogenster, allgemein bekannter Zitate von Rossini und Wagner. Und irgendwie schließt sich damit, im einem unsichtbaren Theaterstück gleichenden Wechselspiel von existentiell Bekennendem und Karikierendem, von dystopisch Aufschreckendem und Transzendentem auch dramaturgisch der eine knappe Jahrhunderthälfte umschließende Kreis von der ersten zur letzten Symphonie.
- Die Symphonien sind einzeln als Studienausgaben bei Boosey & Hawkes erschienen. www.boosey.com
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!