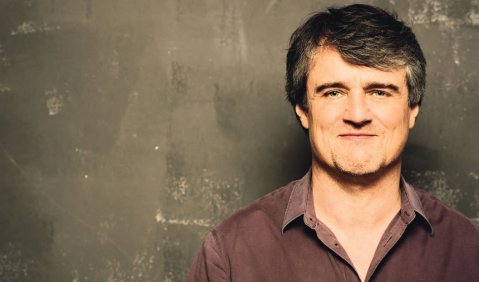Vom 2. bis 20. September 2015 startet das Berliner Konzertleben mit dem Musikfest Berlin in die neue Spielzeit. Zu den Festival-Höhepunkten zählt die Aufführung von Schönbergs Fragment gebliebenem Oratorium „Die Jakobsleiter“ durch das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Albecht Dümling unterhielt sich mit dem Dirigenten über das große Projekt.
neue musikzeitung: Arnold Schönberg ist ein Schwerpunkt des diesjährigen Musikfests Berlin. Herr Metzmacher, was bedeutet dieser Komponist für Sie persönlich?
Ingo Metzmacher: Gekannt habe ich ihn nicht. Aber ich war einmal in Los Angeles in dem Haus, in dem Schönberg gelebt hat. Dort steht noch ein verrostetes Trampolin im Garten. Es hat mich sehr beeindruckt, dass er für seine Kinder ein Trampolin gebaut hat. Als ich noch sehr jung seiner Musik begegnet bin, war das unglaublich wichtig für mich, denn es hat mir die Tür in die Moderne geöffnet. Ich habe seitdem immer wieder Schönberg gespielt und dirigiert. Ich finde ihn faszinierend in seiner Geradlinigkeit, in der Kraft seiner Musik. Ohne Schönberg wäre die Moderne ganz anders verlaufen. Er hat es gewagt, aus dem bekannten System herauszutreten. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie viel Mut man dafür haben musste, und kann das nur bewundern.
nmz: Sie haben mit den Klavierstücken op. 11 begonnen.
Metzmacher: Als Student wollte ich einfach einmal etwas anderes spielen als die anderen. Wahrscheinlich hat irgendein sechster Sinn mich da hingeführt. Diese Stücke sind ja in der entscheidenden Phase geschrieben, als Schönberg diesen großen Schritt gemacht hat – ein Stück Befreiung. Diese Klavierstücke haben mich unheimlich befeuert und mich auf den Weg gebracht, den ich danach gegangen bin.
nmz: Winrich Hopp zufolge geht die bevorstehende Aufführung der „Jakobsleiter“ wesentlich auf Ihre Initiative zurück. Woher kommt das starke Interesse gerade an diesem Werk?
Metzmacher: Mich interessiert vor allem die räumliche Anordnung dieser vier Gruppen, die nicht auf der Bühne sitzen, auch die Tatsache, dass es ein Fragment ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Stück unbedingt machen will.
nmz: Wie sehen Sie den Stellenwert der „Jakobsleiter“ im Gesamtschaffen von Schönberg?
Metzmacher: Das ist ein zentrales Stück für Schönberg, ähnlich wie „Moses und Aron“. Ich bin sicher, dass er es zu Ende komponiert hätte. Er hat ja das, was es gibt, in kürzester Zeit geschrieben, nur unterbrochen durch die Einberufung zum Militär. Die ganze Thematik: Wie stelle ich mich zur Welt, wie stelle ich mich zum Leben im Angesicht des Todes und wie ist es mit dem Glauben – das berührt ja sehr grundsätzliche Fragen. Das ist wirklich ein Stück mit einer Botschaft, aber unvollendet. Schönberg hat es nicht wirklich bewältigt. Das erinnert mich an ein anderes Stück dieser Art, was mich sehr interessiert aus einer ganz anderen Zeit, nämlich der „Lazarus“ von Schubert. Das war ebenfalls ein Thema, das dem Komponisten anscheinend am Schluss unbewältigbar schien. Das ist, wie wenn Sie auf einen ganz hohen Berg steigen wollen – mit der Kraft, etwas Unmögliches anzugehen.
nmz: Die „Jakobsleiter“ sollte eigentlich der letzte Teil einer groß angelegten Symphonie sein. Im monumentalen Anspruch, mit einem Chor von 270 Personen, 10 Piccoloflöten, 18 Klarinetten et cetera ist sie verwandt mit der achten Symphonie von Gustav Mahler oder dem multimedialen Mys-terium von Alexander Skrjabin. Haben diese großen Weltanschauungs-Werke etwas mit dem Umbruch des Ersten Weltkriegs zu tun?
Metzmacher: Wahrscheinlich. Hundert Jahre später kann man sich schwer in diese Situation hineinversetzen. Es ist jedenfalls interessant, dass Schönberg danach total in die Reduktion gegangen ist und seine 2. Kammersymphonie geschrieben hat. Das ist sozusagen der Gegenpol.
nmz: Das Bild der „Jakobsleiter“ stammt aus dem 1. Buch Mose. Schönberg hatte verschiedene weitere Anregungen: Balzac, Swedenborg, Strindberg. Er wollte eigentlich zuerst mit dem Dichter Richard Dehmel zusammenarbeiten, hat den Text dann aber selbst geschrieben. Wie beurteilen Sie diesen Text?
Metzmacher: So ausführlich habe ich mich damit nicht beschäftigt, dass ich dazu etwas sagen könnte. Als Musiker finde ich es aber wahnsinnig interessant, dass der Klang am Schluss sich sozusagen erhebt, wenn die Seele singt und dann langsam im Raum nach oben steigt. Zum Schluss bleibt nur noch eine einsame Geige übrig. Diesen klanglichen Vorgang finde ich spektakulär. Er nimmt in seiner Art Kompositionen vorweg, die sich mit Bewegungen des Klanges im Raum beschäftigt haben, bis hin zu Nono. Schönberg war also auch da ein Pionier. Das interessiert mich als Musiker an dem Stück eigentlich am meisten. Deswegen haben wir auch dafür gekämpft, dass die vier Raumgruppen eben einmal nicht vorher aufgenommen und dann eingespielt werden. Es wird bei dieser Aufführung alles live gespielt. Das ist, glaube ich, noch nie passiert. Das wird besonders spannend. Wir hatten mehrere Besichtigungen in der Philharmonie, um diese Bewegung des Klanges wirklich so zu machen, dass das nachvollziehbar und erfahrbar wird.
nmz: Schönberg hat 1926 für die „Jakobsleiter“ ein Röhrensystem entworfen, um den Klang der Fernorchester im Raum zu verteilen. 1944 wollte er dann dieses System durch Mikrophone und Lautsprecher ersetzen. Aber Sie machen das alles live?
Metzmacher: Wir machen alles live. Für Raummusik ist die Berliner Philharmonie ganz besonders geeignet. Das war auch ein Grund, warum ich es dort unbedingt machen wollte. In einem herkömmlichen Saal können Sie das ja nicht realisieren. Wir werden natürlich die Balkone benutzen und wohl auch eine Position außerhalb. Es soll alles so verteilt werden, dass es eine total räumliche Wirkung ergibt. Live gespielt wirkt das ganz anders als aus dem Lautsprecher.
nmz: Die Melodik ist in der „Jakobsleiter“ oft einfacher als in den Werken der vorangehenden atonalen Phase, etwa bei der „Glücklichen Hand“ oder der „Erwartung“.
Metzmacher: Es ging Schönberg wohl vor allem darum, die Botschaft des Textes zu vermitteln, der in sich auch wieder musikalisch ist. In einem klugen Artikel beruft sich Heinz-Klaus Metzger darauf, dass in Schönbergs Text auch musikalische Vorgänge angezeigt sind.
nmz: Das bezieht sich wahrscheinlich auf die ersten Worte des Erzengels Gabriel „Ob rechts, ob links, vorwärts oder rückwärts, man hat weiterzugehen“. Diese Worte verweisen tatsächlich auf Raumvorstellungen der Zwölftonmusik.
Metzmacher: Richtig. Faszinierend ist auch, dass die Eröffnungstakte die zwölf Töne der Oktave beinhalten, ohne dass Schönberg das danach kontinuierlich fortgesetzt hätte. Aber da ist die spätere Methode, mit zwölf Tönen zu komponieren, schon angelegt. Ich denke manchmal, dass Komponisten in unvollendeten Werken Wege gegangen sind, die sie noch nicht selbst durchdrungen haben. Deswegen war es ihnen nicht möglich, ihr Stück in einer üblichen Weise zu Ende zu komponieren. Das gilt auch für Bruckner und Mahler. Deswegen sind diese Stücke besonders interessant, weil sie auf eine Zukunft verweisen, in der der Komponist selbst noch gar nicht ist mit seinem Kopf. Er behauptet erst einmal etwas, weil er spürt, dass es dort hingeht. Es ist dann aber nicht so leicht, es vollends zu greifen, auch für den Schöpfer nicht. Er reißt dadurch aber Räume auf, die man sonst nie erreichen würde.
nmz: Die letzte Berliner Aufführung dieses Werks fand 2001 zur Eröffnung des Jüdischen Museums statt. Damals dirigierte Kent Nagano das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin. Was empfinden Sie, wenn Sie nun 14 Jahre später die „Jakobsleiter“ mit Ihrem einstigen Orchester zur Aufführung bringen?
Metzmacher: Ich weiß aus meiner Zeit mit denen, dass die das ganz besonders gut spielen. Die Tatsache, dass sie dieses Werk schon kennen, wird natürlich sehr helfen. Ich habe sehr gekämpft für dieses Projekt, weil die Finanzierung nicht ganz leicht war. Aber ich habe zu Winrich Hopp immer gesagt: Wenn nicht beim Berliner Musikfest, wann denn sonst? Vor allem, wenn man einen Schönberg-Schwerpunkt hat. Deswegen bin ich sehr froh, dass es dann doch gelungen ist, das Stück zu programmieren. Wir werden es realisieren.