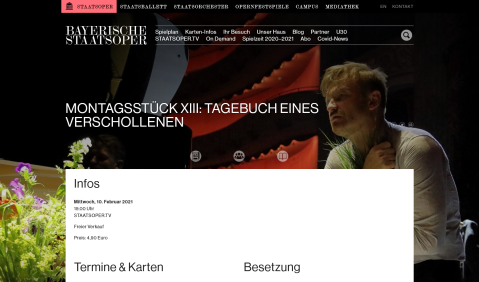Verschollene haben wir auch heutzutage viele: alle jene, die auf den ausbeuterischen Großbaustellen oder in den obskuren Bergwerken unserer Welt Reichtum und Glück finden wollen – und verschollen bleiben … auch an unseren Grenzen. Zog einst Schuberts junger Bursch fremd „ein“ und ins völlig Ungewisse wieder „aus“, so gestaltete fast einhundert Jahre später Leoš Janáček einen, der einer unwiderstehlichen Versuchung folgend.
In der auch noch vom Standesdenken des 19.Jahrhunderts geprägten Gesellschaft der gerade unabhängig gewordenen Tschechoslowakei litt Janáček vielfältig an Konventionen: sowohl als Komponist wie als zunehmend ungebärdiger Mann. Seine Landaufenthalte zeigten ihm die gesetzesähnlichen Regeln im Bauerntum. Deren bis zum Kindesmord führenden Folgen hatte er schon 1905 in seinem packenden Musikdrama „Jenufa“ gestaltet; dort findet das Liebespaar durch alle Düsternis hindurch zueinander - mit am Ende grandios leuchtender Musik.
Fast fünfzehn Jahre später entdeckte Janáček in einer Zeitung einen zunächst anonym erscheinenden Gedichtzyklus, der ihn sofort ansprach: der reiche Bauernsohn Janek verliebt sich völlig unstandesgemäß in die reizvoll schöne Zigeunerin Zefka; hin und her gerissen hadert er mit dem Pflügen, den Ochsen und allem … bis hin zu Gott; als bäuerlicher Romeo spricht er nicht von „Nachtigall“ und „Lerche“, sondern will allen Hähnen die Köpfe abschlagen, damit sie die Nacht mit Zefka länger dauern lassen … all das inspirierte Janáček sofort: schließlich steckte er in seiner völlig erkalteten Ehe fest und hatte die jüngere, hübsche, aber in ihrer Ehe gut situierte Kamilla Stösslova kennengelernt. Sie verklärte er zu seiner leidenschaftlich beschworenen Muse, sah sofort auch „Zefka“ in ihr – und die nur in wunderbaren Briefen ausgesprochene, aber nicht ausgelebte Leidenschaft gestaltete Janáček dann im Liedzyklus als dreiminütiges Furioso für Klavier solo. Und in der Kunst kann er Lebenswahrheit gestalten: dass liebende Leidenschaft konventionelle Grenzen überschreitet – als Janek seine Zefka mit dem neugeborenen Sohn drüben warten sieht, sagt er allem Lebewohl und bricht mit ihr in ein ungewisses Schicksal auf.
All das hat Spielleiterin Friederike Blum auf einem Podest der sonst leeren Bühne des Nationaltheaters konzentriert – als einen der „Montagshappen“ im Theater-Lockdown. Ein einfacher Tisch, mit grobem Leinen bedeckt; ein Topf mit Grünpflanze, der Janek an den Wald der Erstbegegnung erinnert; der Flügel, dessen Musik auch mal die Liebe beschwört und sich in dem einfachen Wiesenblumenstrauß konkretisiert. Auf der Bühne von der Kamera verfolgt, mit dem dunklen Zuschauerraum, also ungewisser Zukunft als Hintergrund gestaltete Tenor Pavol Breslik dann Janeks Ringen. Mit der tschechischen Sprache aufgewachsen, kann er die ganz textbezogenen Gesangslinien auch ganz idiomatisch flüssig artikulieren, so kantig, herb und oft unschwelgerisch klingen lassen, wie Janáček sie komponiert hat. Da ist nichts mehr in romantischer Harmonik geborgen; da sind zwar Volkslied-Wendungen aufgegriffen, aber eben keine „Böhmische Folklore“ und schon gar keine „Zigeuner-Musik“ zu hören – der mitunter eckige, kurz gestaute und dann losbrechende Wortschwall des dörflichen Menschen ist zu hören. Diesen Janáček-typischen Tonfall traf Breslik genau. Nur in den zwei, drei emotionalen Ausbrüchen fehlte ihm emotionale Glut, sie gelangen nur laut. Dass in der fernen Königsloge ein Geflirre aus beleuchteten Plastikbahnen seine Zefka-Begegnung symbolisieren sollte, während dann Mezzosopranistin Daria Proszek doch als Person für das kurze verführerische Duettieren auftritt, bleibt ein nur wenig überzeugender Einfall. Dass Janeks ungestümer Aufbruch dann von Breslik als Kletter-Sturmlauf über die leeren Parkettreihen hinweg vorgeführt wird, ist ein gelungen abschließender Knalleffekt. Denn auf dem Konzertpodium mit befrackten Solisten wirkt Janáčeks unsentimentaler Griff ins herbe Leben oft befremdlicher. Jetzt wirkte die Bandbreite zwischen Janeks Ringen, naturlyrischen Momenten, vehementem Bruch und Aufbruch in Robert Pechanecs Klavier-Begleitung auch so vielfältig und nicht durch Konzert-Steifheit gebändigt.
Fern blieb auch die Diskussion, ob Janáčeks Werk nicht „rassistisch“ sei. Schließlich kommt der Begriff „Zigeuner“ mehrfach vor; Zefka könne das bürgerlich weiße Klischee der „Verführung“ bedienen; Janek versteigt sich im Text anfangs dazu, statt „Zigeuner-Vater“ und „-Mutter“ anzunehmen lieber den eigenen kleinen Finger zu opfern. Doch dem steht ja gerade das Werkende entgegen: die Liebe triumphiert; Mutter und Kind werden nicht allein gelassen; Verantwortung wird übernommen; gemeinsam wird ein anderes Leben versucht. All das liegt auf der großen Grundlinie von Janáčeks Gesamtwerk: er ist der Gestalter leidend großer Frauenfiguren; er beklagt durchweg die Inhumanität so vieler gesellschaftlicher Gegebenheiten; er ist immer auf der Seite der Mühseligen und Beladenen bis hin zu Straftätern „Aus einem Totenhaus“; über dieser, seiner letzten Partitur steht sein Satz „In jeder Kreatur ein Funke Gottes“.
- Ab 10.02. als Video on demand unter Staatsoper.TV für € 4,90 abrufbar: https://www.staatsoper.de/stueckinfo/montagsstueck-xiii-tagebuch-eines-verschollenen/2021-02-10-19-00-1.html