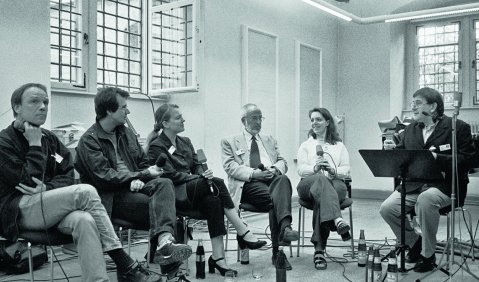Eines der gemeinsamen Themen von nmz und Jeunesses Musicales war und ist die Musikvermittlung. Im deutschsprachigen Raum setzte in diesem Bereich die im Jahr 2000 von der JMD ins Leben gerufene „Initiative Konzerte für Kinder“ wichtige Akzente. Juan Martin Koch blickt zusammen mit der damaligen Projektleiterin Barbara Stiller, heute Professorin an der Hochschule für Künste Bremen, zurück und nach vorne.
neue musikzeitung: Wenn Du an Deine Zeit als Projektleiterin der Initiative Konzerte für Kinder zurückdenkst: Welches Bild kommt Dir da spontan vor Augen?
Barbara Stiller: Zunächst fällt mir dieses friedliche Leben in Weikersheim ein, wo man ganz schön weit weg war vom Kulturleben, wie ich es bis dahin aus den Großstädten kannte. Ich habe Weikersheim aber auch als Ort empfunden, von dem aus man etwas ganz Neues starten konnte – ein kleiner Ort mit sehr viel Energie für solche Themen.
nmz: Wie hat sich die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) dort für Dich präsentiert?
Stiller: Als ein sich gut kennendes Team, das mich sehr offen aufgenommen hat. Es gab eine große Willkommenskultur für ein dort ja auch eher unbekanntes Thema. Man machte sich gemeinsam auf.
nmz: Konzerte für Kinder als neues, unbekanntes Thema, eine Art weißes Papier – war das auch ein Erwartungsdruck?
Stiller: Ich habe das Vertrauen gespürt, dass etwas passieren würde, aber auch – wie immer bei befristeten Projekten – den Anspruch, dies in relativ kurzer Zeit in Meilensteinen und Arbeitspaketen bewältigen zu müssen. Es gab schon eine Struktur, vom Projektantrag ausgehend: Der nahm die ganze Kulturwelt in den Blick, die man auf diese Weise neu beleben wollte. Das war schon sehr groß gedacht, aber es war klar, dass man klein anfangen musste.
nmz: Gab es etwas, was Dich dann im Projektverlauf besonders überrascht hat?
Stiller: Überraschend, ja fast überwältigend war die Offenheit für das Thema auf allen Seiten. Da war man ziemlich schnell an den namhaften Größen des deutschen Kulturlebens dran. Wohin man eine Mail schrieb oder wen immer man anrief: Es kam stets positives Echo zurück. Da flammte etwas auf, das ohne Druck eine angenehme Dynamik der Kommunikation auslöste.
nmz: Man merkte, dass man einen Nerv getroffen hatte, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Thema gesetzt hatte.
Stiller: So war das, ja! Es ging aber nicht darum zu sagen: Ich will das, das und das von Ihnen, sondern darum, auf Dialogebene zu überlegen, in welche Richtung es gehen könnte. Das ist etwas ganz anderes als ein Forschungsauftrag, bei dem am Ende eine eingangs formulierte Forschungsfrage beantwortet werden muss. Es war wirklich eine Aufbruchstimmung.nmz: Aus dem Wissen heraus, dass man in anderen Ländern schon weiter war in Sachen Musikvermittlung entstand dann die Konfiguration des Weikersheimer
Kongresses „Neue Wege für junge Ohren“ im Jahr 2001…
Stiller: Auf der einen Seite war klar, dass es im englischsprachigen Raum schon seit mehreren Jahrzehnten einiges auf diesem Gebiet gab, aus vielfältigen Gründen. Auf der anderen Seite war das Internet noch lange nicht soweit, dass man da einfach nach den Education-Abteilungen und deren Angebot suchen konnte. Man konnte nicht schnell mal Material auf YouTube sichten. So entstand die Idee zum Kongress, der namhafte Persönlichkeiten des internationalen „KoKi-Lebens“ mit jenen persönlichen Kontakten zusammenbrachte, die die JMD über die internationale Jeunesses hatte. Diese ist ja in vielen Ländern, im Gegensatz zu Deutschland, auch als Konzertveranstalter sehr aktiv.
nmz: Den zweiten Kongress in Heek kann man dann als Initialzündung für die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) sehen, oder?
Stiller: Ja, der Weikersheimer Kongress war ja eine bunte Mischung mit vielen Impulsen, unter anderem von Richard McNicol, der anschließend nach Berlin reiste, um Zukunft@BPhil mit aufzubauen. Es entstanden dann erste Kontakte zur DOV und zum Bühnenverein. Ab dem zweiten Kongress in Heek fing die DOV an, sich des Themas Konzerte für Kinder verstärkt anzunehmen, was für die Wirkung in die Orchester hinein natürlich entscheidend war.nmz: 2002 erschien bei ConBrio
das von Dir gemeinsam mit Constanze Wimmer und Ernst Klaus Schneider für die JMD herausgegebene Buch „Spielräume Musikvermittlung – Konzerte für Kinder entwickeln, gestalten, erleben“. Hat es damals seine Ziele erreicht?
Stiller: Das Buch hat viele Menschen erreicht, die auf einen ersten Überblick und Anregungen für die eigene Arbeit warteten. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich Fragen zur Musikvermittlung detaillierter zu beantworten versuchen. Das Buch stellte Konzerte für Kinder insgesamt als ein eher offenes Konzept dar. Die künstlerische Praxis der Musikvermittlung sollte mit ersten theoretischen Ansätzen verzahnt werden, die noch sehr rar gesät waren. Zu diesem Zeitpunkt sprach man ja fast ausschließlich über die Studie zur Konzertpädagogik von Anke Eberwein und darüber, was Ernst Klaus Schneider und andere mit dem Pilotstudiengang in Detmold auf den Weg gebracht hatten.
Problem Selbstreflexion
nmz: Die nmz hat die „KoKi-Initiative“ von Anfang an mit einer eigenen Seite begleitet und dem Thema Musikvermittlung auch danach eine feste Rubrik gewidmet. Da hatten wir vielfach das Problem, wie man über die Beschreibung von Best-practice-Beispielen hinaus- und ins Reflektieren hineinkommen könnte. Wie hat sich das aus Deiner Sicht entwickelt?
Stiller: Das ist bis heute ein Problem, wenn man viele Publikationen ansieht… Wir waren da mit der nmz-Seite schon in einem Reflexionsdiskurs, als es den sonst noch überhaupt nicht gab. Denn vielfach war es ja so, dass man in der Begeisterung darüber, dass überhaupt etwas gemacht wurde, den Zeitpunkt noch nicht gekommen sah, mit kritischen Fragen an sich selbst in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist an vielen Stellen bis heute so geblieben.
nmz: Und deshalb hat dann auch Holger Noltzes Buch „Die Leichtigkeitslüge“ von 2010 so eingeschlagen…
Stiller: Ja, es passte in die Zeit. Über das Buch kann man natürlich diskutieren, weil es auf eine gewisse Weise tendenziös ist, aber es hat nach wie vor seine Berechtigung. Ich nutze es für die Lehre in den Grundlagenkursen der Musikvermittlung bis heute.
nmz: 2007 wurde das netzwerkjunge ohren (njo) gegründet. Inwiefern war und ist es eine Fortsetzung der KoKi-Initiative?
Stiller: Es wurde zunächst ja von allen zu Recht gefeiert, dass es wieder so etwas gab nach der Pause. Gut war auch, dass es sich in Berlin, sozusagen am Nabel des Kulturlebens ansiedelte, gleichzeitig aber internationaler wurde. Wir hatten damals mit der Initiative auch den gesamten deutschsprachigen Raum im Blick, aber dass es jetzt eigene Netzwerke in Österreich und in der Schweiz gibt, ist schon eine Errungenschaft des njo.nmz: Welche Funktion nimmt der junge ohren preis in der Szene aus Deiner Sicht ein?
Stiller: Der Preis ist wichtig und bekannt, er ist sozusagen als Pflock eingeschlagen. Dass man sehr viele motivieren könnte sich zu bewerben, ist allerdings an der hohen Professionalität gescheitert. Vorstellbar wären Preise für bestimmte Nischen, für Nachwuchsprojekte, Mini-Ensembles oder Interdisziplinäres, vielleicht in wechselnden Kategorien.
nmz: Nach und nach ist das Thema Musikvermittlung auch an den Musikhochschulen gelandet. Welche Chancen und Perspektiven sind da erkennbar?
Stiller: Das hängt stark von den Lehrenden, vom Angebot und von den Formaten ab, in denen unterrichtet wird. Die weiterbildenden Studiengänge und der Fortbildungsbereich haben sich bewährt und funktionieren sehr gut. Sie werden nachgefragt, die Leute kommen schon topqualifiziert und inspirieren sich gegenseitig. Bei den grundständigen Angeboten war es schwieriger, denn – so zumindest meine These – in der künstlerischen Ausbildung, wo man so gerne hätte, dass die Studierenden ein Bewusstsein für Musikvermittlung entwickeln, sitzen viele Studierende, die sehr weit weg sind vom hiesigen Musikleben, von den Strukturen und Organisationsformen. Viele fühlen sich überfordert. Anderseits war ich diesen Kursen gegenüber noch nie so positiv aufgeschlossen wie heute. Man muss mit praktischen Beispielen anfangen, von denen es mittlerweile viele im Netz gibt. Darüber kann man in einen guten Dialog kommen. Aber insgesamt muss jede Hochschule einen Weg finden, der in ihr Profil passt, und zum Beispiel entscheiden, ob der Bereich eher an die Musikwissenschaft, das Kulturmanagement oder die Musikpädagogik angedockt ist.
Begriff und Berufsfeld
nmz: Stichwort Musikpädagogik: War die Verwirrung und Debatte um den Begriff Musikvermittlung eher schädlich oder nützlich? War es ein notwendiger Prozess, in dem jetzt Klarheit herrscht?
Stiller: Als dieses Thema aufkam, war das ein wenig diffus: Die einen hatten Angst, dass sie nicht mehr als die einzig und allein musikpädagogisch Tätigen gesehen wurden, die Schulmusiker sahen ihren Bildungsauftrag gefährdet, während die Musiker*innen aus den Orchestern so viel Respekt vor der Musikpädagogik hatten, dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden wollten. Ähnliches erlebe ich jetzt bei Kolleg*innen aus unterschiedlichen Bereichen in Bezug auf die Community Music. Ich selbst sehe da viel eher synergetische Effekte.
nmz: Wenn man das breite Berufsfeld von Musikvermittler*innen ansieht, hat man das Gefühl, dass sie das komplette Musikleben in sich vereinen müssen: künstlerische Aufführung, Organisation, Management, Dramaturgie, Pädagogik, wissenschaftliche Reflexion. Presse- und Lobbyarbeit…
Stiller: Ja, das ist ein enormes Spektrum. Und genau das ist es ja auch, was die Weiterbildungsstudiengänge so attraktiv macht. Im Berufsalltag hängt es dann häufig davon ab, woher die Musikvermittler*innen kommen. Diejenigen, die aus der Musikwissenschaft kommen, gehen oft eher in den Managementbereich, die mehr künstlerisch Orientierten ziehen sich da im Lauf der Zeit eher heraus. Das Problem ist, dass die Stellenausschreibungen sehr offen gestaltet sind und natürlich – siehe die Studie des njo – dass bei enorm
flexiblen Arbeitszeiten nicht gut genug bezahlt wird.
nmz: Und dann sollen sie nebenbei auch nach das Musikleben retten… Tun sie das?
Stiller: Aus Hamburger Sicht kann ich jedenfalls sagen, dass die Ansage schon toll ist, dass alle Hamburger Schüler*innen und Kita-Kinder die Elbphilharmonie von innen kennen sollen, verbunden mit einem wirklich umfassenden Programm. Das hat sehr zur gesellschaftlichen Akzeptanz beigetragen. Die Zeiten von Musentempeln für die High Society sind endgültig vorbei. Hinzu kommt eine junge Generation von Musiker*innen, die sich da einfinden werden. Deshalb sind die grundständigen Lehrangebote an den Hochschulen auch so wichtig, wo erste Einblicke in die Musikvermittlung gegeben werden.
nmz: Wenn Du der JeunessesMusicales ein neues Projekt vorschlagen könntest, was könnte das sein? Was wäre eine Baustelle, der sie sich annehmen könnte?
Stiller: Es wäre wahrscheinlich zu einfach zu sagen, dass es ein aktuelles Thema wie Klima oder Globalisierung sein könnte, das mit Musikvermittlung zusammenzubringen wäre. Aber Zukunftsszenarien, Utopien zu entwickeln, das wäre schon interessant. Die Anfänge der Initiative Konzerte für Kinder waren ja doch sehr von dem Bewusstsein eines Erhaltens geprägt. Die schöne, heile Kulturwelt sollte den Kindern näher gebracht werden. Da mal in ganz andere Richtungen zu denken, das wäre schon spannend… ¢