So ganz ohne jeden Bezug zueinander ist das nicht: seit den jüngsten Umzug von Axel Springers Tageszeitung „Die Welt“ von Hamburg nach Bonn ist man geneigt, dem Deutschen Musikrat, der diesen Wechsel von der Peripherie zu den zentralen Bürokratien und Amtsstellen der Bundesregierung schon einige Jahre früher (1971) vollzog, geradezu hellseherische Qualitäten zuzubilligen. Seinem taktischen Vermögen, vorwiegend aber seiner zielstrebigen Arbeit und Ausdauer mag es über die inzwischen an den entsprechenden Quellen gewonnenen Erfahrungen hinaus zuschreiben sein, daß es ihm nach langem Hickhack […] gelungen ist, das in vier Jahren entwickelte Projekt „Deutscher Musikwettbewerb“ definitiv durchzuführen […]

Vor 50 Jahren: Erster Deutscher Musikwettbewerb in Bonn
Dem Einwand, ob es denn derzeit nichts Dringlicheres an bildungspolitischen Aufgaben gebe als die Gründung dieses nur Bundesbürgern und West-Berlinern vorbehaltenen Unternehmens, aber auch dem, wonach sich solches in einer Zeit des allgemeinen Zwanges zum Sparen nicht mehr von dessen Trägern, den Verantwortlichen der inflationären Kulturetats der Länder wie des Bundesinnenministeriums. mit dem unerläßlichen Anspruch seiner Notwendigkeit vertreten lasse, trat man von offizieller Seite gleich mit mehreren Argumenten entgegen. Musikrats-Präsident Siegfried Borris versuchte ihn mit der Überzeugung zu entkräften, daß die Musik auch in Zukunft in unserer Gesellschaft eine integrale Rolle spielen werde, wobei es nicht gleichgültig sein könne, ob diese Leistung in zunehmendem Maße von einer internationalen Elite junger Interpreten übernommen würde, weil es den einheimischen Spitzenbegabungen bislang noch immer an jenem letzten Durchbruchsvermögen gefehlt habe. Zu Recht wies er darauf hin, daß es ihnen an innerem Ausreifen und echtem Hineinwachsen in Konzertpraxis und Bühnenbewährung mangele, was im Vergleich zu Russen und Amerikanern beispielsweise, die ohne solche Erfahrungen kein internationales Wettbewerbspodium betreten, geschweige denn ein Engagement eingehen, völlig zutreffend ist.
Ein exemplarischer Neubeginn
So habe denn hinsichtlich der notwendig daraus resultierenden Chancen-Benachteiligung, meinte Borris, ein Ausgleich geschaffen werden müssen: gegenüber dem Stipendienreichtum in westlichen Ländern wie gegenüber der kulturpolitischen Konsequenz staatlicher Förderung in den Ländern des Ostens. Bundesinnenminister Werner Maihofer ging es hingegen um die Rückgewinnung des stark ramponierten Ansehens der deutschen Kulturnation, was ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und Selbstbehaupten voraussetze, Als höchste Erfüllung des Schöpferischen seien Kunst und Kultur anzusehen und daher vom Staat jederzeit zu fördern, zumal es, wie er kritisch anmerkte, die Privatwirtschaft an solcher Bereitschaft leider überwiegend fehlen lasse. In diesem Sinne sei der „Deutsche Musikwettbewerb“ ein exemplarischer Neubeginn.
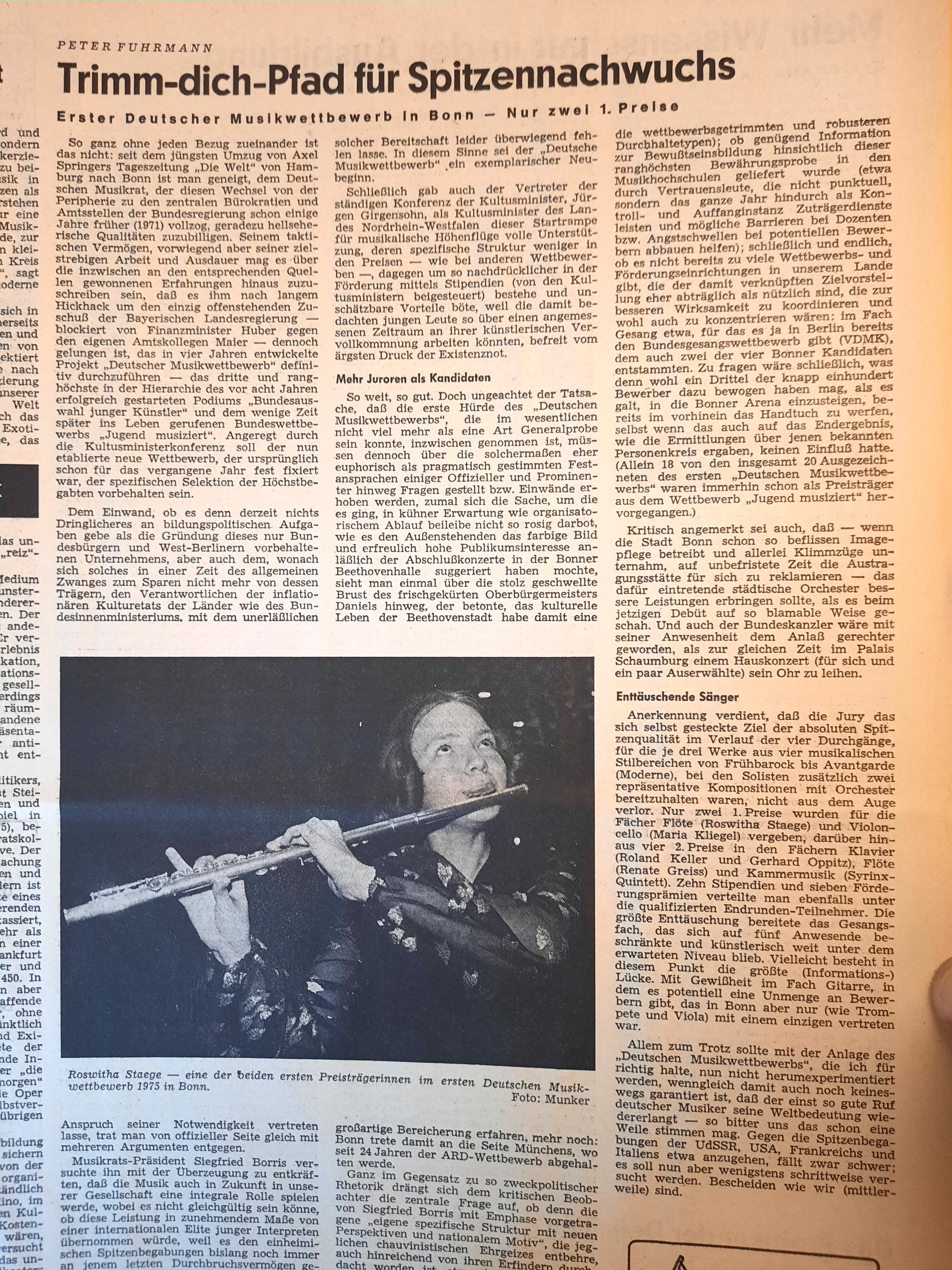
Peter Fuhrmann, Neue Musikzeitung, XXIV. Jg., Nr. 4, September 1974
Schließlich gab auch der Vertreter der ständigen Konferenz der Kultusminister, Jürgen Girgensohn, als Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen dieser Startrampe für musikalische Höhenflüge volle Unterstützung, deren spezifische Struktur weniger in den Preisen – wie bei anderen Wettbewerben –, dagegen um so nachdrücklicher in der Förderung mittels Stipendien (von den Kultusministern beigesteuert) bestehe und unschätzbare Vorteile böte, weil die damit bedachten jungen Leute so über einen angemessenen Zeitraum an ihrer künstlerischen Vervollkommnung arbeiten könnten, befreit vom ärgsten Druck der Existenznot.
Mehr Juroren als Kandidaten
So weit, so gut. Doch ungeachtet der Tatsache, daß die erste Hürde des „Deutschen Musikwettbewerbs“, die im wesentlichen nicht viel mehr als eine Art Generalprobe sein konnte, inzwischen genommen ist, müssen dennoch über die solchermaßen eher euphorisch als pragmatisch gestimmten Fest ansprachen einiger Offizieller und Prominenter hinweg Fragen gestellt bzw. Einwände erhoben werden, zumal sich die Sache, um die es ging, in kühner Erwartung wie organisatorischenm Ablauf beileibe nicht so rosig darbot, wie es den Außenstehenden das farbige Bild und erfreulich hohe Publikumsinteresse anläßlich der Abschlußkonzerte in der Bonner Beethovenhalle suggeriert haben mochte, sieht man einmal über die stolz geschwellte Brust des frischgekürten Oberbürgermeisters Daniels hinweg, der betonte, das kulturelle Leben der Beethovenstadt habe damit eine großartige Bereicherung erfahren, mehr noch: Bonn trete damit an die Seite Münchens, wo seit 24 Jahren der ARD-Wettbewerb abgehalten werde. Ganz im Gegensatz zu so zweckpolitischer Rhetorik drängt sich dem kritischen Beobachter die zentrale Frage auf, ob denn die von Siegfried Borris mit Emphase vorgetragene „eigene spezifische Struktur mit neuen Perspektiven und nationalem Motiv“, die jeglichen chauvinistischen Ehrgeizes entbehre, auch hinreichend von ihren Erfindern durchdacht worden ist, etwa dahingehend, ob es überhaupt genügend Kandidaten für eine jährliche Testaktion mit so hohem Niveauanspruch hierzulande geben kann; ob man nicht besser einen Zwei- bis dreijährigen Turnus und darin eine bestimmte Auswahl an Testfächern (anstelle des Totals von Vokal-und Instrumentalgattung) fixiert und damit sich die Erfahrungen des ARD-Wettbewerbs zunutze gemacht hätte; ob es vermeidbar gewesen wäre, in den einzelnen Fachgebieten mehr Juroren als Kandidaten aufzubieten; ob es sich mit der Sache verträgt, daß Juroren zugleich auch die Lehrer einzelner Kandidaten sind; ob überhaupt die Jury-Zusammensetzung so beschaffen sein muß; ob es nicht immer wieder die gleichen Leute sind, die zunächst durch interne Hochschulwettbewerbe wie andere (ARD, Mendelssohn-Preis, Karajan-Stiftung, Studienstiftung usw.) gefördert nunmehr fast sportlich angetrieben und dann auch noch, zuweilen von den gleichen Lehrer Juroren, die man gewiß durch unabhängige ausländische Persönlichkeiten ersetzen könnte, noch einmal auf bundesdeutscher Topstufe dekoriert, wenn nicht gar hart enttäuscht werden (bei achttägigem Stress reüssieren ja nicht notwendigerweise die sensibleren talentierten jungen Leute, als vielmehr die wettbewerbsgetrimmten und robusteren Durchhaltetypen); ob genügend Information zur Bewußtseinsbildung hinsichtlich dieser ranghöchsten Bewährungsprobe in den Musikhochschulen geliefert wurde (etwa durch Vertrauensleute, die nicht punktuell, sondern das ganze Jahr hindurch als Kontroll- und Auffanginstanz Zuträgerdienste leisten und mögliche Barrieren bei Dozenten bzw. Angstschwellen bei potentiellen Bewerbern abbauen helfen); schließlich und endlich, ob es nicht bereits zu viele Wettbewerbs- und Förderungseinrichtungen in unserem Lande gibt, die der damit verknüpften Zielvorstellung eher abträglich als nützlich sind, die zur besseren Wirksamkeit zu koordinieren und wohl auch zu konzentrieren wären: im Fach Gesang etwa, für das es ja in Berlin bereits den Bundesgesangswettbewerb gibt (VDMK), dem auch zwei der vier Bonner Kandidaten entstammten. Zu fragen wäre schließlich, was denn wohl ein Drittel der knapp einhundert Bewerber dazu bewogen haben mag, als es galt, in die Bonner Arena einzusteigen, bereits im vorhinein das Handtuch zu werfen, selbst wenn das auch auf das Endergebnis, wie die Ermittlungen über jenen bekannten Personenkreis ergaben, keinen Einfluß hatte. (Allein 18 von den insgesamt 20 Ausgezeichneten des ersten „Deutschen Musikwettbewerbs“ waren immerhin schon als Preisträger aus dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ hervorgegangen.) Kritisch angemerkt sei auch, dass – wenn die Stadt Bonn schon so beflissen Imagepflege betreibt und allerlei Klimmzüge unternahm, auf unbefristete Zeit die Austragungsstätte für sich zu reklamieren – das dafür eintretende städtische Orchester bessere Leistungen erbringen sollte, als es beim jetzigen Debüt auf so blamable Weise geschah. Und auch der Bundeskanzler wäre mit seiner Anwesenheit dem Anlaß gerechter geworden, als zur gleichen Zeit im Palais Schaumburg einem Hauskonzert (für sich und ein paar Auserwählte) sein Ohr zu leihen.
Enttäuschende Sänger
Anerkennung verdient, daß die Jury das sich selbst gesteckte Ziel der absoluten Spitzenqualität im Verlauf der vier Durchgänge, für die je drei Werke aus vier musikalischen Stilbereichen von Frühbarock bis Avantgarde (Moderne), bei den Solisten zusätzlich zwei repräsentative Kompositionen mit Orchester bereitzuhalten waren, nicht aus dem Auge verlor. Nur zwei 1. Preise wurden für die Fächer Flöte (Roswitha Staege) und Violoncello (Maria Kliegel) vergeben, darüber hinaus vier 2. Preise in den Fächern Klavier (Roland Keller und Gerhard Oppitz), Flöte (Renate Greiss) und Kammermusik (Syrinx Quintett). Zehn Stipendien und sieben Fördeungsprämien verteilte man ebenfalls unter die qualifizierten Endrunden-Teilnehmer. Die größte Enttäuschung bereitete das Gesangsfach, das sich auf fünf Anwesende beschränkte und künstlerisch weit unter dem erwarteten Niveau blieb. Vielleicht besteht in diesem Punkt die größte (Informations-) Lücke. Mit Gewißheit im Fach Gitarre, in dem es potentiell eine Unmenge an Bewerbern gibt, das in Bonn aber nur (wie Trompete und Viola) mit einem einzigen vertreten war. Allem zum Trotz sollte mit der Anlage des „Deutschen Musikwettbewerbs“, die ich für richtig halte, nun nicht herumexperimentiert werden, wenngleich damit auch noch keineswegs garantiert ist, daß der einst so gute Ruf deutscher Musiker seine Weltbedeutung wiedererlangt – so bitter uns das schon eine Weile stimmen mag. Gegen die Spitzenbegabungen der UdSSR, USA, Frankreichs und Italiens etwa anzugehen, fällt zwar schwer; es soll nun aber wenigstens schrittweise versucht werden. Bescheiden wie wir (mittlerweile) sind.
Peter Fuhrmann, Neue Musikzeitung, XXIV. Jg., Nr. 4, September 1974
- Share by mail
Share on