Als bemerkenswertes Kennzeichen der diesjährigen 55. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, die kürzlich in Erlangen tagte, erhebt die Einführung einer besonderen Abteilung für Musikwissenschaft einiges Anrecht auf allgemeinere Beachtung. In der von Wissenschaftlern und Schulmännern aus allen Teilen des Reichs und dem benachbarten Ausland sehr stark besuchten Eröffnungssitzung begründete der I. Vorsitzende der Tagung, Geheimrat Professor Dr. Otto Stählin (Erlangen), die Berechtigung dieser neuen Abteilung mit dem eindrucksvollen Hinweis auf eine neue Auffassung von der Bedeutung der Musikwissenschaft, die sich infolge des Aufschwungs der Geisteswissenschaften in den letzten Jahrzehnten ziemlich allgemein durchgesetzt und auch die Universitäten immer lebhafter ergriffen hat. Als Hilfswissenschaft für alte und neue Sprachen und als Geschichte der Musik, so führte der Redner aus, habe die Musikwissenschaft ihr verbrieftes Recht im Kreise der philosophischen Fakultätsdisziplinen und ihren angestammten Platz als eine der sieben freien Künste im Lehrbetrieb der deutschen Hochschulen zurückerobert. Handelt es sich doch bei der Errichtung von Lehrstühlen und Seminaren für das musikwissenschaftliche Fach an unseren Hochschulen tatsächlich um keine modische Neuerung, sondern um eine Erneuerung und Verjüngung einer mittelalterlichen Universitätstradition, und sind es doch gerade die ältesten Universitäten, z. B. in England, an denen das Fach seit dem I3. Jahrhundert in ununterbrochener Tradition gepflegt und auch der akademische Grad eines Doctor musicae bis auf unsere Tage verliehen wird. Weiter machte der Redner darauf aufmerksam, daß sich die heutige musikwissenschaftliche Forschung nicht mehr damit begnüge, die musikalischen und musikgeschichtlichen Einzelerscheinungen und -tatsachen in ihrer Isolierung zu betrachten, sondern dem Zuge der mächtig aufstrebenden akademischen Kunst- und Literaturwissenschaft folge und bemüht sei, die inneren sachlichen Beziehungen der Einzelerscheinungen objektiv zum Ausdruck zu bringen und ihre Zusammenhänge mit der gesamten geistig-gesellschaftlichen Kultur zu erfassen in der Ueberzeugung, daß sich der Geist einer Zeit und eines Volkes in der Musik ganz unmittelbar offenbare.

Neue Musik-Zeitung – Vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Mittelalterliche Musik in Erlangen
In diesem Zusammenhang kündigte der Redner als Beispiel für seine Auffassung von der Bedeutung der Musikwissenschaft den Vortrag von Professor Dr. Rudolf v. Ficker (Innsbruck) über „Die Musik des Mittelalters und ihre Beziehungen zum Geistesleben an“, der die „Vorführung mittelalterlicher Musik“ durch Mitglieder des musikwissenschaftlichen Seminars und des Collegium musicum der Universität und Schüler der Realschule Erlangen unter Leitung des dortigen Privatdozenten der Musikwissenschaft, Dr. Gustav Becking, und Studienrats Oskar Dischner einleitete.
Vortrag und Vorführung waren in hohem Maße geeignet, die Bedeutung der Musik für das geisteswissenschaftliche Erkennen der Vergangenheit im allgemeinen und der aus innerer Verwandtschaft mit unserer Zeit neu erschlossenen geistigen Kultur des Mittelalters im besonderen darzutun. Die Musik des Mittelalters steht heute im Mittelpunkt des Interesses der wissenschaftlichen Musikgeschichtsschreibung und hat die Forschung vor ganz neuartige Probleme der Materialerschließung und der geschichtlichen Interpretation gestellt.
Hier setzte Fickers Vortrag ein, der in großen Zusammenhängen darlegte, wie sich der Musikbegriff des Mittelalters von unserem heutigen gangbaren unterscheide, wie die mittelalterliche Musik durch das Vorherrschen bald akkordlicher, bald rhythmischer, bald melodischer Momente in ihrer Entwicklungsbahn gekennzeichnet und wie erst am Ausgang des Mittelalters infolge Ausgleichs und gegenseitiger Durchdringung dieser jeweils vorherrschenden Momente, das was wir heute Musik nennen, zu erkennen sei: eine Einheit akkordlicher, rhythmischer und melodischer Faktoren.
Zur Illustration des an neuen Gesichtspunkten und Ausblicken reichen Vortrags dienten neben Lichtbildern von mittelalterlichen Kunstdenkmälern und Notenbeispielen, sowie zwei Grammolaaufnahmen orientalischer Musik eine größere historisch getreue und künstlerisch lebensvolle Aufführung ausgewählter Musikdenkmäler des Mittelalters. Leider war bei dieser Auswahl die Frühzeit und Hochblüte gegenüber der Spätzeit zu schwach vertreten: von I5 Werken gehörten 9 dem I5. Jahrhundert und nur 6 dem 12., I3, und I4. Jahrhundert an. Und doch ist das spezifisch Mittelalterliche der Musik gerade an der außerordentlich reichen musikalischen Ueberlieferung des I2., I3. und I4. Jahrhunderts namentlich Frankreichs besonders lehrreich zu studieren.
Ein nach Ausstattung und Inhalt wertvolles Programmheft, das mit einem prächtigen Faksimile eines dreistimmigen Kyrie von G. Dufay aus einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Cambrai in kunstvoller schwarz-roter Notierung geschmückt war, bot Vortragsfolge, Texte mit Uebersetzung und sehr sorgfältiger Quellenangabe, womit sich die Veranstaltung bewußt in die Reihe der historischen Aufführungen mittelalterlicher Musik stellt, die I922 in der Badischen Kunsthalle zu Karlsruhe und 1924 in der Hamburger Musikhalle stattgefunden haben.
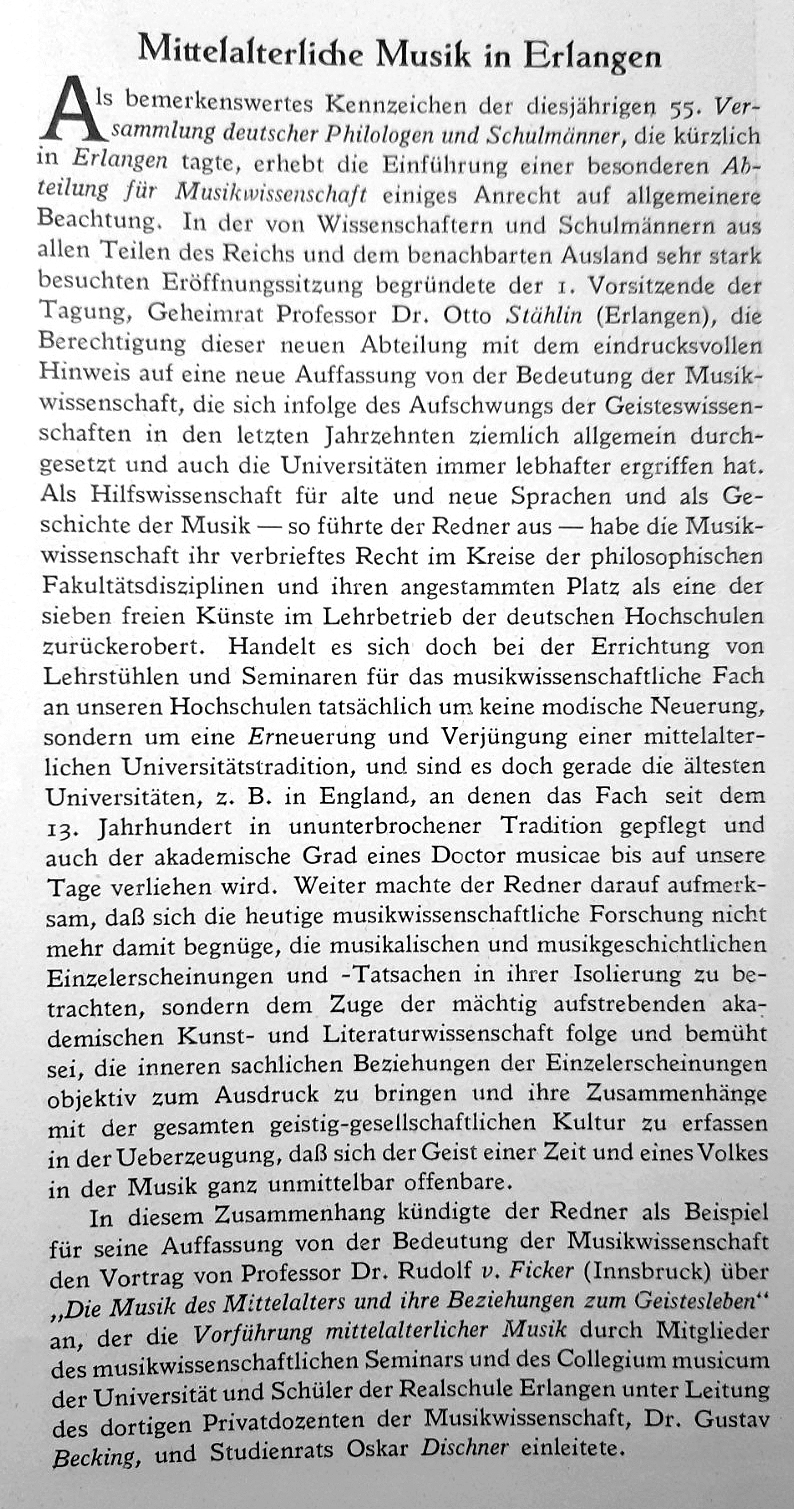
Vor 100 Jahren: Mittelalterliche Musik in Erlangen
Zu Anfang der Erlanger Vorführung wurden die Proprium Stücke der Osterliturgie mit der schönen Wipo’schen Ostersequenz Victimae paschali laudes nach der Editio Vaticana vorgetragen von ehemaligen Studierenden der Regensburger Kirchenmusikschule unter der meisterhaften Leistung ihres um die Pflege des gregorianischen Chorals und der katholischen Kirchenmusik hochverdienten Direktors, Geheimrat Professor Dr. Karl Weinmann. Aus der unübersehbaren Fülle uns überlieferter mehrstimmiger Musik des Mittelalters folgten als Beispiel eines zweistimmigen Organum ein Osteralleluja Pascha nostrum von Magister Leoninus, darauf ein Conductus und zwei Motetten aus der berühmten Bamberger Motettenhandschrift. Die Unterstimmen des Conductus und der Tenor der Motette „Brumans est mors“ waren mit herabgestimmten Violen, alle übrigen Stimmen vocaliter besetzt. Mit besonders eindringlicher Wirkung kam die Motette „Bele Ysabeloth“ mit ihrer wunderbar reich bewegten Oberstimme, die von W. Goetz (Solotenor) sehr charakteristisch vorgetragen wurde, zu Gehör. Hier war auch das in den meisten übrigen Stücken des Programms ziemlich verschleppte Tempo richtig getroffen und durchgehalten. Die anschließenden beiden Werke (Rondeau und Motette) von G. de Machaut, dem führenden musikalischen Genius des französischen Trecento zeigten in ihrer melodisch-harmonischen Beweglichkeit und phantasievollen Klangpracht schon so stark hervortretende neuzeitliche Züge, daß man zweifeln konnte, ob diese Trecentokunst nicht bereits ein Neuansatz, eine Ars nova in Frankreich darstellt. Jedenfalls bildeten diese Werke einen auch aufführungstechnischen Höhepunkt der Vorführung, und namentlich ließ die dreistimmige weltliche Motette „Quant en moy vint premierement“ in der charakteristisch bunten Besetzung mit Knabenstimmen, Solotenor, Posaune und Violen, die nach Form und Farbe dem klassisch geschulten Hörer zunächst ganz unzugänglich scheint, den modernen Musiker begeistert aufhorchen. Die burgundische Musik des I5. Jahrhunderts war mit drei Kompositionen über die marianische Antiphon Ave regina coelorum und zwei Chansons von Binchois und Dufay vertreten. Die rein instrumentale Besetzung und wiederum starke Verschleppung des Tempos der Chansons brachte zwar hervorragend schöne Musikstücke zum Vorschein, entstellte aber durchaus den ursprünglichen Charakter dieser burgundischen Liedkunst. Unter den geistlichen Kompositionen des I5. Jahrhunderts, die den Abschluß der mitsamt Vortrag vier Stunden umspannenden und die Aufnahmefähigkeit auch der unbefangensten Zuhörer angesichts der oft recht schwer zugänglichen Musik überschreitenden Veranstaltung bildeten, hinterließ den nachhaltigsten Eindruck das allerdings auch künstlerisch ganz einwandfrei, sicher und geschlossen rein vokal aufgeführte herrliche Salve regina von Dufay.
Im Interesse der Zuhörer wäre zu wünschen gewesen, wenn Vortrag und Vorführung äußerlich voneinander abgesondert, dafür aber innerlich in engeren Zusammenhang und bessere Uebereinstimmung gebracht worden wären. Zweifellos hätte dann die so außerordentlich verdienstvolle und auf einem gründlichen Studium der alten Musik und Musikübung, sowie auf wissenschaftlich einwandfreien Aufführungsbedingungen beruhenden Veranstaltung als Ganzes gewonnen, und wäre es auch jedem Zuhörer möglich gewesen, der Vorführung bis zuletzt beizuwohnen und somit tiefer in den Geist der Musik des Mittelalters einzudringen, dessen eigentümliche Größe, die sich dem Verstehen eben nur im Hören erschließt, in seiner unsere Zeit überragenden Unmodernität zu suchen ist. Nichts wäre dem wissenschaftlichen Wert historischen Musizierens abträgiger, als wenn alte Musik „modern“ oder gar – Mode werden sollte.
W. Gurlitt, Neue Musik-Zeitung, 47. Jg., 2. November-Heft 1925
- Share by mail
Share on