Christoph Türcke: Philosophie der Musik, C.H. Beck, München 2025, 510 S., € 38,00, ISBN 978-3-406-82994-9
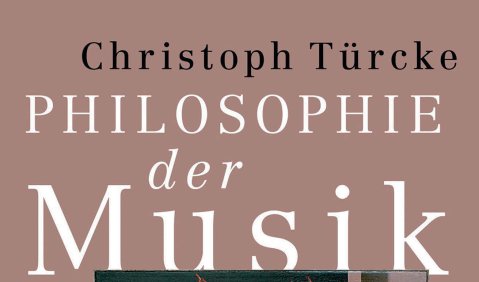
Christoph Türcke: Philosophie der Musik, C.H. Beck, München 2025, 510 S., € 38,00, ISBN 978-3-406-82994-9
Die Suche nach den Ursprüngen
Das war’s. Eine Überdehnung der linken Hand – eine mögliche Karriere als Geiger hatte sich damit erledigt. Doch die Musik hat den Leipziger Philosophie-Professor Christoph Türcke auch nach diesem frühen Rückschlag nie losgelassen. Nach etlichen Buch-Publikationen zu gesellschaftskritischen Themen („Lehrerdämmerung“, „Digitale Gesellschaft“, „Erregte Gesellschaft“ u.a.) knüpft Türcke nun indirekt an ein Buch von 2011 an: Auf die „Philosophie des Traums“ folgt nun eine rund 500-seitige „Philosophie der Musik“.
„Was ist das für ein merkwürdiges, ebenso penetrantes wie scheues Etwas, welches durch unsere Ohren tief in uns eindringt, im Nu erklingt, im Nu verklingt, uns erschüttert, rührt oder erheitert, jedenfalls bewegt und prägt – und sich doch nicht festhalten lässt?“ So fragt Türcke zu Beginn und gliedert seine Antwort in fünf „Akte“ mit mehreren „Intermezzi“, zuzüglich einer „Ouvertüre“ und einer „Coda“.
Dass Türcke nicht an einem engeren Musik-Begriff klebt, sondern ihn bewusst weit fasst und ihn auch immer wieder hinterfragt, zeigt sich schon recht früh. Im Eiltempo mäandern seine Gedanken durch klangliche Phänomene und streifen innerhalb weniger Zeilen von Schönberg über Goethe zu den „Klanglandschaften des amazonischen Urwalds“. Gedankenschärfe und Gedankentiefe legen eine Reihe von Beobachtungen offen, darunter auch Missverständnisse wie die „Verkennung von Klanglandschaften als Idealmusik, der Koryphäen wie Bach, Mozart oder Ives sich lediglich annäherten, die aber erst erreicht werde, wenn die Menschheit ihren Austritt aus dem Zusammenklang der Natur […] rückgängig macht und sich wieder mit einem Nischendasein in der Gesamtnatur begnügt.“
Türcke beginnt bei frühmenschlichen Lautformen, ordnet musiknahe Laute mehrfach menschlichen Gefühlen wie Schrecken, Angst, Freude oder auch Träumen zu. Musik als Reflex, als Bestandteil unserer Lebensbedingungen, könnte man sagen. Denn: „Musik ist nicht autark“. Dieses Geflecht, in dem sich musikalische Klänge und Laute in einer Wechselrede mit Mensch und Umwelt bewegen, beleuchtet Türcke eindrucksvoll.
Das Verhältnis von Sprache und Musik lässt sich nicht trennen, und so landet Türcke zwischendurch automatisch bei der Kunstmusik, etwa wenn er behauptet, dass es Bach im Schlusschor der „Johannes-Passion“ gelinge, „auf hochartifizielle Weise eine Urszene ‚der Musik überhaupt‘ wiederaufleben zu lassen“.
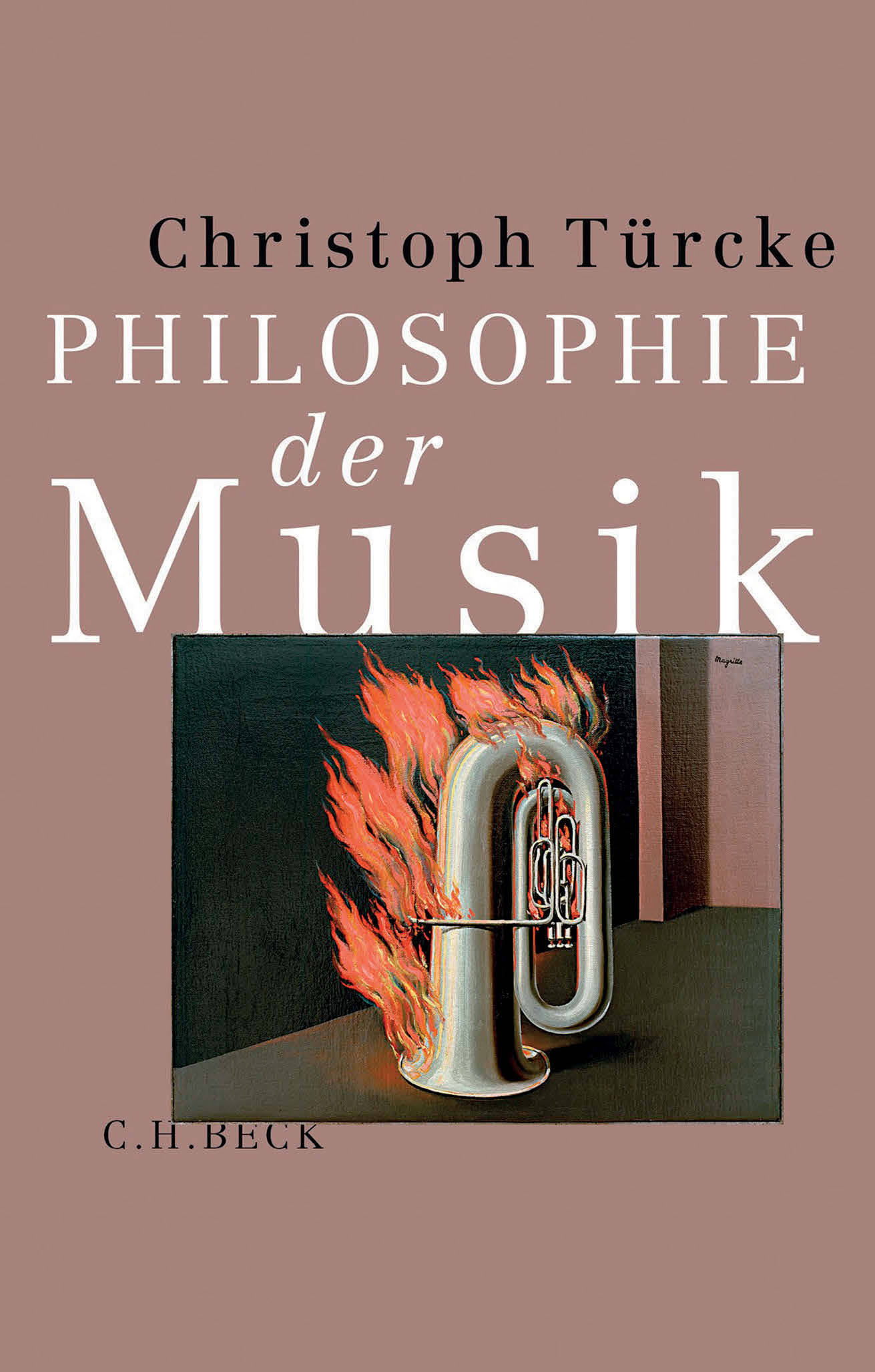
Christoph Türcke: Philosophie der Musik, C.H. Beck, München 2025, 510 S., € 38,00, ISBN 978-3-406-82994-9
Einen ganzen „Akt“ widmet der Autor den Musikinstrumenten (mit einem Intermezzo zu Mahlers „Knochenflöte“), ihrer Entstehung und ihrem Widerstreit untereinander. Ein anderer Akt beleuchtet die Tonalität, darunter die frühen Psalmen, „der musikalische Grundbestand der christlichen Feier“ – wie überhaupt das Christentum sich durch einen Drang „zum Ausdruck reiner Empfindung in reinen Tönen“ auszeichne. Dieser „romantischen Kunstform“, wie Hegel sie bezeichnet, gilt ein weiteres „Intermezzo“. Lobgesang, Jubel – aus schlichten Klängen leitet sich eine wachsende Komplexität ab, die Lust am harmonischen Experiment. „Zwar interpretiert die Musik nach wie vor ‚etwas‘: heilige Texte. Aber zugleich geht sie dazu über, sich selbst zu interpretieren.“ Unterschiedliche Intervalle erhalten unterschiedliche Funktionen, Ge- und Verbote durchdringen mehr und mehr die Musik(geschichte), markant etwa in der Form der Fuge: „Sie war zunächst ein gelockerter Kanon, gerade nicht das starr durchkonstruierte Gebilde, als das sie später unter dem Eindruck von Bachs architektonischer Meisterschaft verkannt wurde“.
Kein Zweifel: Christoph Türcke hat ein ungemein komplexes, vielschichtiges Buch vorgelegt, das wahrlich keine eilige Lektüre erlaubt. Es ist eine tiefschürfende Studie, an deren Ende wir bei uns vertraut wirkenden Formen wie Sonate und Oper landen, schließlich beim Jazz in seinen Ursprüngen und beim Rap. Überhaupt ist die Suche nach Ursprüngen eines der zentralen Anliegen dieses Buches. Und: „Wo die Musik ganz Gegenwart ist, ist sie nicht nur ganz Gegenwart. Wo immer sie Unerhörtes erklingen lässt, schwingt auch nicht mehr Hörbares und Verstummtes mit – ,sucht sie, was zu früh geendet‘.“
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!