Selten hat man hierzulande Gelegenheit, zeitgenössische Kompositionen aus Afrika zu hören. Insofern ist diese Veröffentlichung des Signum Quartetts mit Streichquartetten diverser Komponisten-Generationen Südafrikas echtes Neuland. +++ Dorothee Schabert war Tonmeisterin beim SWR und hat etliche Neue Musik-Produktionen aus der Innenperspektive erlebt. Ihr CD-Debüt als Komponistin trägt den potentiell überstrapazierten Titel „HörLandschaften“ +++ Die 50. Folge der musica viva CD-Reihe feiert Jubiläum mit einem ganz besonderen Kaliber: Luciano Berios „Coro“ (1975/76)
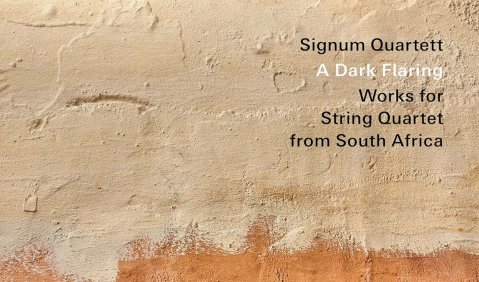
Selten hat man hierzulande Gelegenheit, zeitgenössische Kompositionen aus Afrika zu hören. Insofern ist diese Veröffentlichung des Signum Quartetts mit Streichquartetten diverser Komponisten-Generationen Südafrikas echtes Neuland
Universale Hörlandschaften
Selten hat man hierzulande Gelegenheit, zeitgenössische Kompositionen aus Afrika zu hören. Insofern ist diese Veröffentlichung des Signum Quartetts mit Streichquartetten diverser Komponisten-Generationen Südafrikas echtes Neuland. Mokale Koapengs „Komeng“ (2002) mag für europäische Ohren im ersten Augenblick klingen wie Philip Glass, beruht jedoch auf polyrhythmischen Praktiken eines einheimischen Initiationsritus. „(rage) rage against the“ von Matthijs van Dijk hingegen entwirft eine Klanglandschaft zum Thema Tod, entsprechend zerklüftet die Topografie, entsprechend unbarmherzig die Gesten. Die tonalen „Five Elegies“ (1940/41) von Arnold van Wyk präsentieren mitten im 2. Weltkrieg emotionale Befindlichkeiten zwischen Trauer, Zuversicht und Wut; Schostakowitsch lässt hier grüßen.
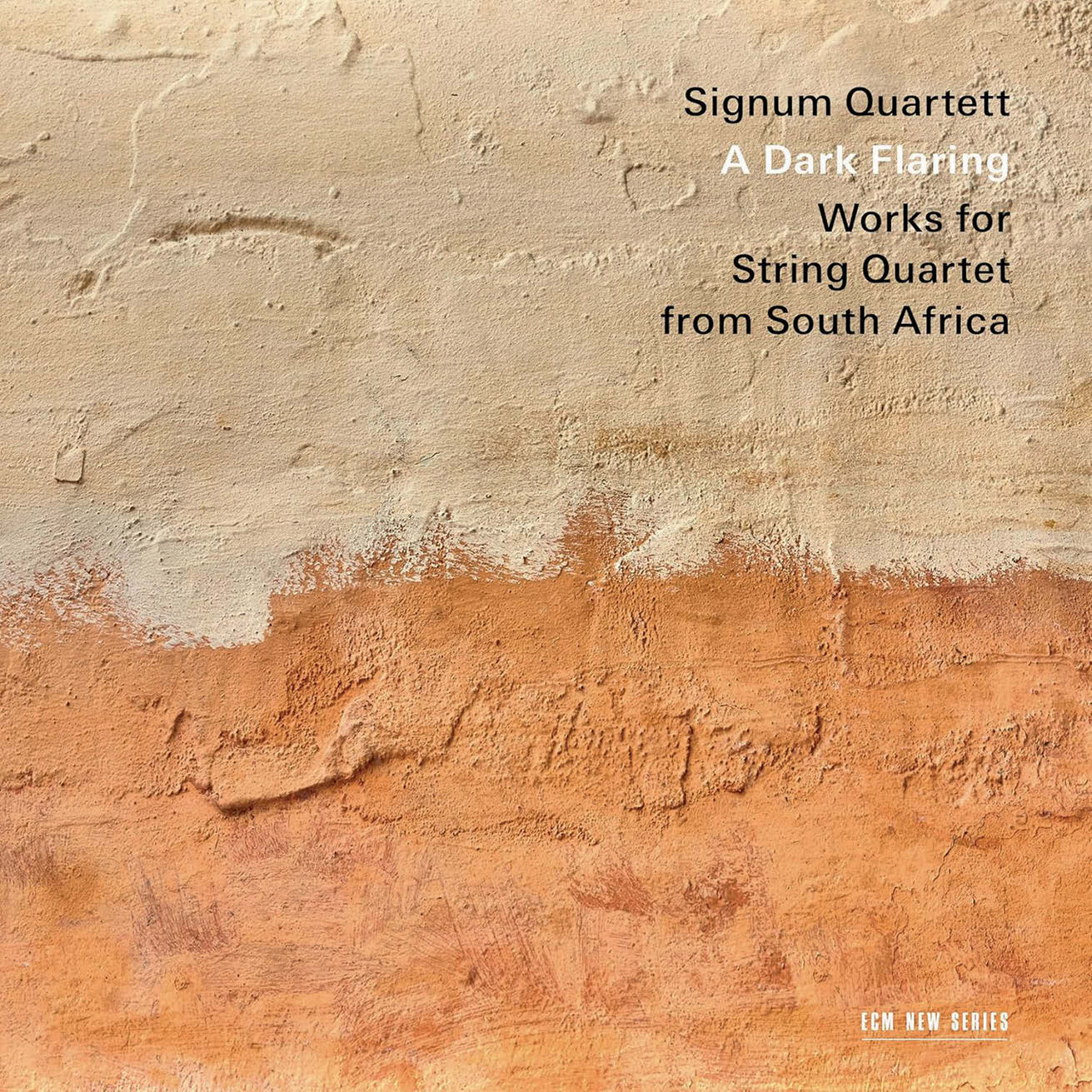
Selten hat man hierzulande Gelegenheit, zeitgenössische Kompositionen aus Afrika zu hören. Insofern ist diese Veröffentlichung des Signum Quartetts mit Streichquartetten diverser Komponisten-Generationen Südafrikas echtes Neuland
Eher Bartók’sche Töne schlägt das „Quartet for Strings“ (1939) der nach London ausgewanderten Komponistin Priaulx Rainier an. Péter Louis van Dijks „iinyembezi“ (2000) greift auf Material von John Dowland ebenso zurück wie auf perkussive Klänge des aus Zimbabwe stammenden Daumenklaviers. Deutlich afrikanische Rhythmen greift auch Robert Fokkens’ „Glimpses of a half-forgotten future“ (2012) auf, gebrochen durch introspektive Momente der Melancholie. Unterm Strich ist dieser Querschnitt durch 80 Jahre Streichquartett-Komposition in Südafrika zwar naturgemäß ziemlich kolonial getuned, aber dennoch spannend vielgestaltig. (ECM)
Dorothee Schabert war Tonmeisterin beim SWR und hat etliche Neue Musik-Produktionen aus der Innenperspektive erlebt. Ihr CD-Debüt als Komponistin trägt den potentiell überstrapazierten Titel „HörLandschaften“, aber hier macht das wirklich einmal Sinn: Spezifische Orte und Landschaften waren wichtige Anregungen für die hier eingespielten Kammermusiken. Das heißt aber nicht, dass der Hörer es mit „Tonmalereien“ zu tun hätte. Schaberts insbesondere in Skandinavien und Südfrankreich gewonnene Eindrücke dienten als Impulsgeber für offene Klanglandschaften, die ihren ganz eigenen Wegen folgen. Allen gemein ist eine Konzentration auf elementare Klanggesten, mit feinen Zwischenwerten von Ton und Geräusch, die die Schärfe des Zuhörens immer wieder neu herausfordern – flüchtig und entschieden, präsent und verletzlich. Aber es ist keine falsche Idylle, die hier beschworen wird. In „La Vallée de Mandailles“ für Holzbläser und Perkussion bringen plötzlich in die Stille hineingetrommelte Marschrhythmen ganz andere Wirklichkeiten ins Spiel. (Neos)
Die 50. Folge der musica viva CD-Reihe feiert Jubiläum mit einem ganz besonderen Kaliber: Luciano Berios „Coro“ (1975/76) ist ein Schlüsselwerk der Vokalmusik des 20. Jahrhunderts: Ein polyglottes, interkulturelles „Oratorium“, das Textmaterial aus Polynesien, Peru, Gabun, Kroatien, Italien, Chile, Persien und des indigenen Amerika mit den politisch aufgeladenen Zeilen Pablo Nerudas verknüpft. In 31 Episoden werden zwischen Klavierlied, Volkston, Vokaltheater und fast sakral irisierender Mikropolyphonie diverseste Satz- und Artikulations-Techniken abgerufen, vom Chor des Bayerischen Rundfunks fabelhaft realisiert. Besonders fasziniert zeigte sich Berio von der Polyrhythmik der afrikanischen Banda Linda (die György Ligeti viel später ebenfalls für sich entdeckte). Die Neruda-Interpolationen sind in massiver, dissonanter Flächigkeit gesetzt und wachsen im Verlauf des Geschehens zu bedrohlichen Manifesten des Schreckens an. Deren leitmotivisch durch das Werk retardierende Textzeile hat an Aktualität nichts eingebüßt: „Kommt und seht das Blut auf den Straßen.“ Flankiert wird Berios „Coro“ von einem klangsatten UA-Mitschnitt der „Automatones“ (2022/23) von Vito Zuraj, inspiriert durch die gleichnamigen lebensechten Metallfiguren der griechischen Mythologie. Wenn Zuraj für großes Orchester schreibt, heißt es in der Regel klotzen, nicht kleckern und so werden auch hier alle Register eines entfesselten Instrumentalapparates gezogen: orchestrale Massenbewegungen, die permanent mutieren oder sich in unzählige Einzelteile auflösen, mit ekstatischen Wiederholungsschleifen und grotesken melodischen Ereignissen – dasOrchester als riesiger Klang-Android. (BR-Klassik, erhältlich ab 7.11.)
Weiterlesen mit nmz+
Sie haben bereits ein Online Abo? Hier einloggen.
Testen Sie das Digital Abo drei Monate lang für nur € 4,50
oder upgraden Sie Ihr bestehendes Print-Abo für nur € 10,00.
Ihr Account wird sofort freigeschaltet!