Es müssen nicht die Pyramiden und auch nicht der Aachener Dom sein. Bei manchen Gebäuden, Landschaften und Handlungen merkt man oftmals sehr schnell, wie sehr sie etwas Besonderes an sich haben: sie sind gigantisch groß, Jahrhunderte alt oder es wird etwas mit einer erstaunenswerten Fingerfertigkeit hergestellt. Bei manchen Gebäuden und Gegenden möchte man selbst hinfahren und sie betrachten, manche Fähigkeiten hätte man auch gern. Dinge und Fähigkeiten, die das Wesen der Menschheit betreffen, ja, ausmachen, werden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben. Wir schauen auf eines der jüngsten Mitglieder der Welterbe-Familie: den Glockenguss und die Glockenmusik.
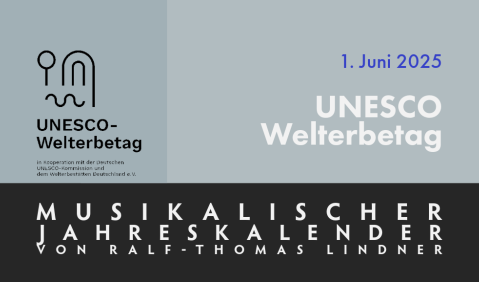
Musikalische Jahrestage: Unesco Welterbetag 2025
Musikalische Jahrestage (20) – 1. Juni – Welterbetag
Was haben Hebammen, Glocken und italienische Pizza gemeinsam? Essen Hebammen vielleicht in ihrer Pause, die am Mittag von den Glocken des naheliegenden Kirchturms her eingeläutet wird, besonders gern italienische Pizza? Möglich, aber die drei haben eine generationenumspannende Gemeinsamkeit: sie gehören zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Dabei geht es um den Schutz, die Erhaltung und die Weitergabe oftmals uralter Traditionen. – Was mag wohl im Laufe der Geschichte an kreativen Ideen wieder vergessen worden sein?
Bereits 1954 wurden in der sogenannten Haager Konvention erstmals internationale Normen zur Erhaltung des Kulturerbes formuliert. Am 16. November 1972 wurde dann in Paris das „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ verabschiedet, dem sich heute 196 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verpflichtet fühlen. In Deutschland wurde das Abkommen 1977 durch Bundesgesetz ratifiziert.
Durch das Abkommen sollen nicht nur durch Kriege, sondern auch durch die Ausbreitung der Zivilisation bedrohte Kulturgüter und Naturstätten geschützt werden. Die einzelnen Staaten sind für die Erfassung, den Schutz und die Erhaltung des auf ihrem Gebiet befindlichen Welterbes selbst zuständig. In diesem Zusammenhang betont Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, dass es „schließlich um das Erbe der Menschheit und eben nicht um ein Tourismussiegel für herausragende europäische Kulturstätten“ gehe.
Welterbe – das ist mehr als die Weitergabe von verstaubten Geschichten und Traditionen. Es ist vielleicht das, was Miraculix meint, wenn er sagt, dass diese Dinge nur von „Druidenmund zu Druidenohr“ weitergegeben werden. In moderner und werbewirksam knapper Sprache heißt das dann: „Wissen. Können. Weitergeben.“ Da gibt es etwas, das funktioniert – schon seit langer Zeit. Es steht möglicherweise für ein Bedürfnis oder eine Tradition. Das wissen wir und können es auch ausführen. Unsere Verantwortung besteht darin, dass es nicht durch Unachtsamkeit in unserer Generation in Vergessenheit gerät. Oftmals kann man immaterielles Kulturerbe dort unerwartet entdecken, wo man es am wenigsten erwartet: in einem vertrauten Handgriff, in einem wiederkehrenden Ritual oder in regionalen Festen und überliefertem Wissen.
Wovon reden wir hier eigentlich? Ein kurzer ungeordneter Blick in das Deutsche Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes zeigt die Vielfalt des Kulturerbes: Ostfriesische Teekultur, Trakehner Zucht, Blaudruck, Orgelbau und Orgelmusik, Knickpflege in Schleswig-Holstein, Hessischer Kratzputz, Falknerei, Biikebrennen, Verwendung und Weitergabe der Brailleschrift in Deutschland, Skat spielen, Zwiefacher und viele mehr. Auf der Liste des UNESCO-Welterbes sind derzeit 1223 Welterbestätten verzeichnet, 952 Kultur- und 231 Naturerbestätten.
„Neben Schutz und Erhalt der Welterbestätten ist es von gleichwertiger Bedeutung zu vermitteln, was Welterbe ist und warum Welterbe für uns alle als völkerverbindendes, friedenserhaltendes und nachhaltig angelegtes Programm so wichtig ist“, erweitert die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, den Blick über die eigenen kleinen Staatsgrenzen hinaus.
Normalerweise werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf die anderen Feiertage, die auch auf dem Portal „Kuriose Feiertage“ verzeichnet sind. Der Welterbetag ist allerdings dort nicht verzeichnet. Auch stehen die anderen wohl nicht in irgendeinem direkten Zusammenhang mit dem Welterbetag: Tag des Modellflugs in Deutschland, der Weltmilchtag, der Welt-Naturisten-Tag, der US-amerikanische Tag des Nagellacks, der US-amerikanische Tag der Olive, der Internationale Kindertag, der US-amerikanische Sag-etwas-Nettes-Tag und der Geburtstag von Oscar aus der Sesamstraße. Allein „Sjómannadagurinn“, der Tag der Seeleute und Fischer in Island und Welttag der Riffe könnten wohl vielleicht einmal die Chance haben, als Weltkulturerbe anerkannt zu werden.
Heiße Sache
Wir wollen heute exemplarisch für das Welterbe einen Blick auf etwas werfen, was erst in diesem Jahr in die deutsche Liste aufgenommen worden ist: Glockenguss und Glockenmusik. – „Horch! Das Feuerglöcklein gellt: Hinter’m Berg, Hinter‘m Berg, Brennt es in der Mühle!“, schreibt Eduard Möricke in seinem Gedicht „Der Feuerreiter“. In diesem Beispiel wird eine der wichtigsten Aufgaben einer Glocke herausgestellt: Glocken sind seit alters her Signalinstrumente, Signalgeber. Sie warnen vor Feuersbrunst und rufen zum Gottesdienst. Sie gliedern den Tag zwischen Morgen-, Mittags- und Abendläuten, das Leben zwischen Taufglocke, Hochzeitsgeläut und Sterbeglocke. – „Nur ewigen und ernsten Dingen sei ihr metallener Mund geweiht, heißt es in Friedrich Schillers „Lied der Glocke“.

Beim Glockenguß geht es um Präzision und das richtige Tempo. Oft kommen Besuchergruppen aus den Auftraggeberkirchengemeinden zum Glockenguss zu Besuch. © Thomas Lohnes
Über Glocken könnte man vieles erzählen. Sie selbst aber sind nicht in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen, sondern der Glockenguss und die Glockenmusik. Darauf wollen wir auch unser Augenmerk lenken. – Heiß geht es her, wenn an einem Freitag um 15 Uhr die Glocken gegossen werden. Das flüssige Metall hat eine Temperatur von etwa 1100° C und es muss – wenn es erst einmal losgeht – alles schnell und ohne Verzögerung in einem großen Wurf vonstattengehen.
Freitag, 15 Uhr
Zur Sterbestunde Jesu Christi (Freitag, 15 Uhr) werden seit alters her neue bronzene Kirchenglocken gegossen. Tradition und ein bisschen Betriebsgeheimnis sind die wichtigsten Zutaten für eine neue Glocke. Viele Dinge kann man beim Glockenguss direkt verfolgen und sehen. Zwei Dinge aber machen die besondere Kunst der Glockengießer aus: das genaue Mischungsverhältnis der Metalle, aus denen die Glocke gegossen wird, und die Gestaltung der äußeren Form der Glocke.
Der erste Arbeitsschritt ist die Erstellung der Schablone mit der äußeren und inneren Form der Glocke. Sie ist so groß wie der halbe Querschnitt des Glockenkörpers. Später wird diese Schablone über dem Glockenkern an einer Achse drehbar befestigt und umreißt so die gesamte Glockenform, die ja rotationssymmetrisch ist. Durch die Schablone sind der Ton und auch der Klang der Glocke schon festgelegt. – Schiller hat das alles ganz genau beschrieben.
Glockenkern
Der Glockenkern wird aus Lehmziegeln gemauert und ist innen hohl. Der Kern wird mit feinem Lehm bestrichen. Dadurch, dass man die Schablone über diesem Lehm dreht, wird überschüssiger Lehm entfernt, und es entsteht eine glatte Oberfläche. So entsteht die Form für die Innenseite der Glocke. Im hohlen Kern wird dann ein Feuer angezündet, um den Lehm zu trocknen. Über der getrockneten Lehmschicht wird dann die „falsche Glocke“ aufgebracht, die auch wieder aus Lehm besteht.

Der Kern der Glockenform wird aus Lehmziegeln gemauert. © Thomas Lohnes
„Falsche“ Glocke
Auch sie wird wieder mit einer Schablone geformt, von überschüssigem Lehm befreit und glatt gestrichen. Auf dieser falschen Glocke werden bereits alle Schriften, Verzierungen und Bilder angebracht. Wieder wird alles von innen her getrocknet. Die falsche Glocke entspricht in ihrer Form dabei schon vollständig dem Endprodukt.

Mit einer Schablone wird der „falschen“ Glocke die endgültige Form gegeben. © Thomas Lohnes
Glockenmantel
Über der falschen Glocke wird der Mantel angebracht: mehrere Lehmschichten, die – ähnlich wie bei Holzfässern – zusätzlich auch noch durch Metallringe verstärkt werden. Ist auch der Mantel getrocknet, wird dieser von der falschen Glocke wieder abgehoben. Da die einzelnen Schichten mit Trennmitteln eingestrichen waren, lässt sich der Mantel gut von der falschen Glocke trennen, die jetzt zerschlagen wird. Übrig bleiben also der Kern und der Mantel, die noch einmal gut gereinigt und dann wieder zusammengesetzt werden. Wo zuvor die falsche Glocke war, ist nun ein Hohlraum.

Als äußere Hülle bekommt die Glockenform ihren Mantel – zwischen Kern und Mantel ist ein Hohlraum, der zuvor von der „falschen“ Glocke ausgefüllt wurde und nun das Metall beim Guss aufnehmen soll. © Thomas Lohnes
Schon aus Kostengründen werden nach Möglichkeit mehrere Glocken gleichzeitig gegossen. Die fertigen Formen werden in eine Grube gestellt, die dann vollständig mit Erde ausgefüllt wird. Die Erde wird verdichtet, damit der ungeheure Druck, der beim Guss entsteht, die Glockenformen nicht zerstören kann. Jede der Formen bekommt dann die sogenannte Krone mit dem Eingussloch und den Windpfeifen. Durch die Windpfeifen können beim Guss entstehende Gase entweichen und werden dort abgefackelt.
Schon früh am Morgen des Tages, an dem der Glockenguss erfolgen soll, wird der Schmelzofen angeheizt und das Metall geschmolzen. Die Bronzelegierung, die bei etwa 1100°C entsteht, besteht zu etwa 20 bis 24 Prozent aus Zinn und 76 bis 80 Prozent Kupfer. Diese flüssige Glockenspeise wird dann genau um 15 Uhr durch die auf der Grube gemauerten kleinen Kanäle geleitet, die zu den Kronen der Glockenformen führen, und fließt in den Hohlraum, den zuvor die falsche Glocke eingenommen hat. Ob der Guss gelungen ist, erfährt man oft erst mehrere Wochen später, wenn die Glocken abgekühlt sind und wieder ausgegraben werden.
Glockenmusik
Auf den ersten Blick scheinen Glocken – sieht man einmal von ihrer Größe, ihrem Gewicht und ihrer Lautstärke ab – relativ unspektakuläre und im wahrsten Sinne des Wortes „eintönige“ Musikinstrumente zu sein. Die einfachste Form von aufgezeichneter Musik für Glocken findet man in den sogenannten Läuteordnungen. Hier wird festgelegt, wann welche Glocke zu welchem Zweck läuten soll: Eine Glocke zur Tauge eines neuen Gemeindegliedes, eine andere Glocke als Sterbeglocke für ein ehemaliges Gemeindemitglied. Beide Glocken zusammen mit einer dritten – fertig ist das Hochzeitsgeläut. Sieben Schläge einer Glocke bei den sieben Bitten des Vaterunsers. Das System ist ausgeklügelt und umreißt die Ereignisse eines Gottesdienstes, eines Tages, eines Jahres oder eines Menschenlebens. – Nicht alle Glockensignale sind kirchlichen Ursprungs. Wir haben schon von dem Feuerglöcklein gehört, das auch Sturm, Krieg, Frieden und so vieles mehr verlauten lassen kann.
Zur Glockenmusik gehören alle Glockenspiele an Kirchen, Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Oftmals sind sie auch mit einer Figurengruppe kombiniert, die zum Beispiel eine regionale Begebenheit darstellt, etwa das Goslarer Glockenspiel im Zwerchgiebel des Kämmereigebäudes, wo die Geschichte des Rammelsberger Bergbaus von der sagenhaften Entdeckung durch den Ritter Ramm bis hin zur Neuzeit dargestellt wird. Der Rammelsberger Bergbau war wesentlich mitverantwortlich für den Reichtum der Stadt. Als Musik erklingen hier Bergmannsweisen.
Zur Glockenmusik gehören natürlich auch die zahlreichen Handglockenchöre. Es bedarf schon eines guten musikalischen Vorstellungsvermögens eines jeden Mitspielenden, wenn man zu einem Musikstück nur einzelne Töne beisteuern darf. – Natürlich gibt es immer wieder auch Kompositionen, wo die „normalen“ Kirchenglocken mit anderen Musikinstrumenten gemeinsam erklangen und gemeinsam ihre Stimmen zu einer Komposition werden lassen. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist der Anfang von „Praeludium, Kyrie, Sanctus“ (1966) für zwei Orgeln, Solosänger, zwei Chöre und Kirchenglocken des schwedischen Komponisten Bengt Hambraeus.
Orgelpunkt
Ein interessantes weiteres Beispiel: In der Orgelmusik hat man immer wieder gefragt, wie in Notenausgaben aufgezeichnete Orgelpunkte zu spielen seien. Orgelpunkte – das sind lange Haltetöne im Bass, über denen sich das musikalische Geschehen abspielt. Den Reiz machen hierbei die harmonischen Reibungen und Dissonanzen aus, die sich zwischen dem Halteton und den sich darüber frei bewegenden anderen Stimmen ergeben können.
Zwei Probleme gab es bei den erwähnten Noten: Zum einen war der grundsätzlich tiefe Orgelpunkt am unteren Ende der Tastatur mit den Händen oft nicht spielbar, weil beide Hände im oberen Bereich der Tastatur spielten und der Abstand zwischen oben und unten für die Hände zu groß war. Zum anderen hatten viele Orgeln in der Frühzeit noch keine Pedaltasten, sodass der Orgelpunkt nicht von einem Fuß auf einer Pedaltaste hätte übernommen werden können.
Gut, ein zweiter Spieler, der die tiefe Note festhält, wäre eine Lösung gewesen. Für diese Aufgabe hätte man auch keine besonderen musikalischen Fähigkeiten gebraucht. Jeder hätte hier hilfreich einspringen können. Man könnte aber auch die Glocke verwenden: Wenn man den Glockenton quasi als Orgelpunkt verwendet, so ist der Klang vollständig. Ob diese Technik tatsächlich angewendet wurde, ist leider bis heute unklar, aber sie bietet eine Lösung für ein in Noten aufgezeichnetes Stück Musik. Auf der CD „Orgellandschaften. Ostfriesland“ improvisiert Thiemo Janssen auf einer der ältesten und pedallosen Orgeln der Welt in Rysum in Ostfriesland unter Einbeziehung der dortigen Kirchenglocke. Ein spannendes Stück Musik zweier Instrumente, die so beieinander wohnen!
Weitere Informationen:
- Homepage der Deutschen UNESCO Welterbe-Kommission
- Die Zeitschrift Politik und Kultur beleuchtet in ihrer aktuellen Ausgabe das Thema „Welterbe“ (pdf)
- Share by mail
Share on
