[…] Hanns Eisler, der Schüler Schönbergs, der seinen Lehrer den „wahren Konservativen“ nannte und seit etwa 1928 zusammen mit Künstlern wie Bertolt Brecht, Erich Weinert, Ernst Busch eine proletarisch-revolutionäre Kunst an der Seite der KPD entwickelte und praktizierte, dann von den Faschisten vertrieben wurde – dieser Hanns Eisler erlebte nach dem 2. Weltkrieg ein wechselvolles und jeweils bezeichnendes Schicksal im Musikleben der beiden deutschen Staaten.

Kolloquium über „Hanns Eisler heute“ in Ostberlin
In Westdeutschland als „Politkomponist“ verschrien, waren ihm die Konzertsäle verschlossen; erst seit Ende der 60er Jahre bahnt sich langsam eine Eisler-Renaissance an, wenngleich auch zumeist beschränkt auf das rein instrumentale Schaffen; eine rühmliche Ausnahme bildete im Frühjahr 1973 die Aufführung der Kantate „Die Mutter“ (Gorkij/Brecht) durch Studenten der Stuttgarter Musikhochschule.
In der DDR wiederum wurde lange der Komponist der Songs und Massenlieder bevorzugt – ein einseitiges Bild, an dessen Korrektur seit einigen Jahren kräftig gearbeitet wird: fast alle wichtigen Instrumentalwerke sind plattenproduziert worden, und die Leipziger „Gruppe Neue Musik Hanns Eisler“ widmet sich seit 1970 neben dem zeitgenössischen Musikschaffen der DDR intensiv auch der Kammermusik Eislers.
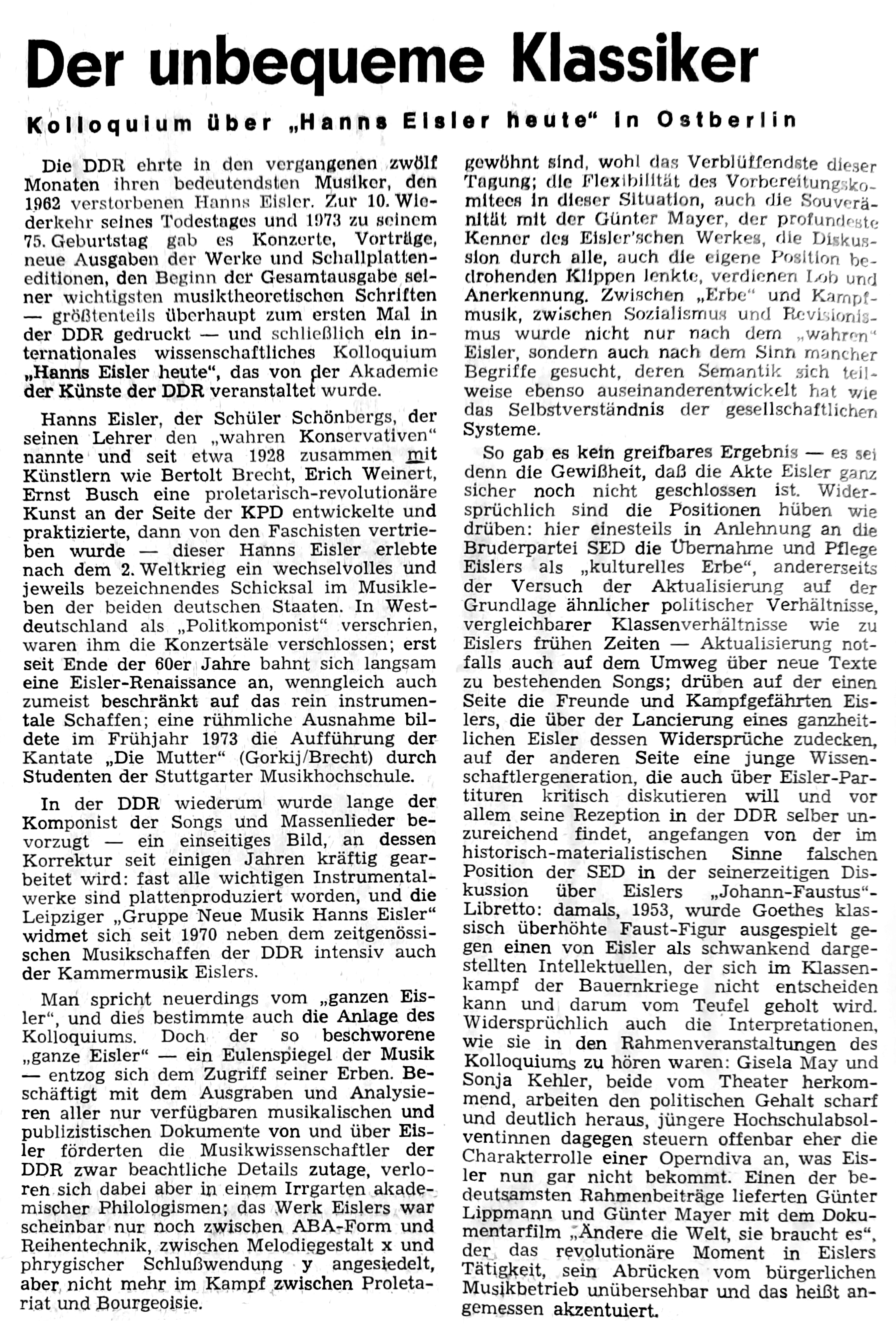
Hartmut Lück, Neue Musikzeitung, XXIII. Jg., Nr. 1, Feb./März 1974
Man spricht neuerdings vom „ganzen Eisler“ und dies bestimmte auch die Anlage des Kolloquiums. Doch der so beschworene „ganze Eisler“ – ein Eulenspiegel der Musik – entzog sich dem Zugriff seiner Erben. Beschäftigt mit dem Ausgraben und Analysieren aller nur verfügbaren musikalischen und publizistischen Dokumente von und über Eisler förderten die Musikwissenschaftler der DDR zwar beachtliche Details zutage, verloren sich dabei aber in einem Irrgarten akademischer Philologismen […]
Eisler, der Mozart und Beethoven verehrte, aber den ebenso klassischen Hölderlin durch Textmontagen „entgipste“, der überzeugter Kommunist war, gleichzeitig aber seinen Genossen ankreidete, sie benähmen sich in der Ästhetik „wie Barbaren, nicht unähnlich unseren Vorgängern, den Jakobinern“ – er ist als „ganzer Eisler“ wohl gar nicht zu fassen. Auch er ist zu „entgipsen“, wenn man ihn „beerben“ will.
Hartmut Lück, Neue Musikzeitung, XXIII. Jg., Nr. 1, Feb./März 1974
- Share by mail
Share on