Zuallererst sei festgestellt: das Mannheimer Nationaltheater hat sich dadurch, daß es dieses Stück zur Uraufführung brachte, unbestritten ein Verdienst erworben; denn jede Gelegenheit, unseren künstlerischen Horizont zu erweitern, muß dankbar begrüßt werden. Ziel des Bearbeiters Carl Orff war, der deutschen Bühne neues, lebendiges Kunstgut zu übermitteln; dies Ziel ist jedoch nicht ganz erreicht worden.

Neue Musik-Zeitung – Vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Monteverdis „Orfeo“
Für die Gründe, daß es nicht ganz erreicht wurde, kommen drei Möglichkeiten in Betracht: erstens das Publikum mit noch mangelnder Einstellung auf das neuartige Gebotene, zweitens die Art der Aufführung, drittens das Werk selbst, und, was es dieses wiederum anbelangt, auf der einen Seite Orff, auf der andern Monteverdi. Man sieht also, daß, um ein ausführliches und gerechtes Urteil abgeben zu können, hierzu eine gründliche Kenntnis Monteverdis und seiner Zeit im allgemeinen, eine genaue Kenntnis eben dieses Monteverdisehen Werkes in seiner überkommenen und seiner durch Orff gegebenen Gestalt im besonderen, sowie ein mehr als einmaliges Anhören der Aufführung notwendig wäre. Die folgenden Ausführungen geben nun das wieder, was nach einmaligem Hören ohne weitere besondere Vorbereitung gesagt werden kann. Dies hat seinen großen Nachteil, aber vielleicht auch seinen kleinen Vorteil, indem der Standpunkt des Rezensenten auf diese Weise dem des naiven Theaterbesuchers am meisten angenähert ist, und für diesen muß das Werk, so es Lebenskraft besitzen, lebendig sein.
Der Tatbestand liegt so: Monteverdi hat seine Oper „Orfeo“ im Jahre 1607 aus Anlaß und zur Verherrlichung eines Hochzeitsfestes am Mantuaner Hof geschrieben; sie ist also ein Gelegenheitswerk in besonderem Maße und enthält folglich vieles, was wohl für den damaligen Hof, aber nicht mehr für unser heutiges Opernpublikum von Belang sein kann. Es ist klar, daß, wenn dieses Werk zu neuem Leben erweckt werden sollte, zunächst alles, was nur durch diese besondere Gelegenheit bedingt war, beseitigt werden mußte. Dies ist das erste. Nun hat sich aber auch der allgemeine Geschmack seit 1607 so geändert, daß selbst nach Ausmerzung dieser Teile uns immer noch manches als durchaus zeitlich bedingt, also künstlerisch tot, erschiene. Zur künstlerischen Wiederweckung des Werks mußten also auch noch diese so erscheinenden Bestandteile ausgeschieden und zum Teil durch andere ersetzt werden. Ein dritter Umstand ist der, daß es eine genaue Partitur des musikalischen Teils dieser Oper nicht gibt, indem die Instrumente häufig nur ungefähr angegeben sind, bei den Rezitativen nur eine Baßstimme dazu aufgezeichnet ist. Hier mußte also neu instrumentiert, fehlende Stimmen hinzu komponiert werden.
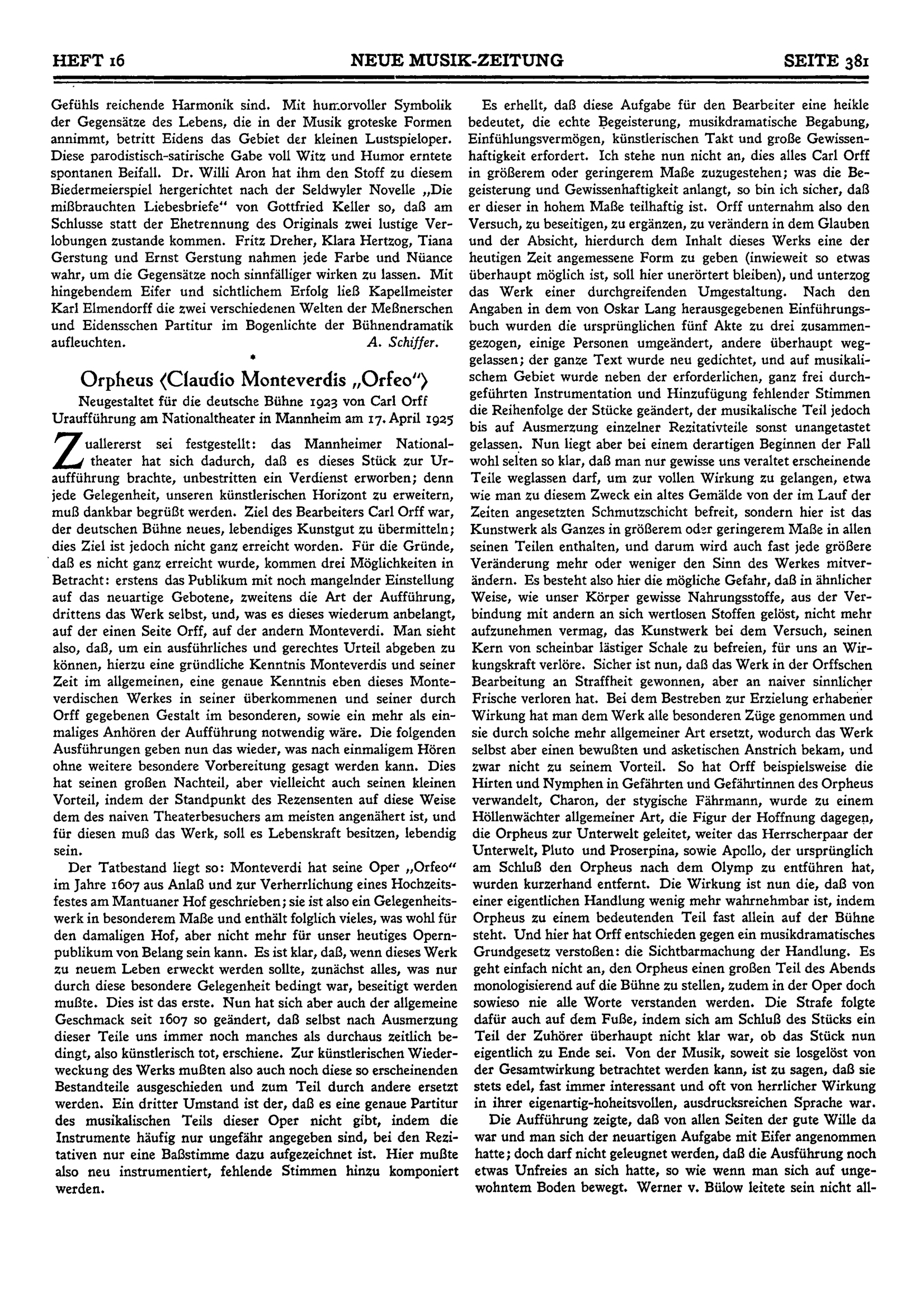
Dr. H. E., Neue Musik-Zeitung, 46. Jg., Heft 16, Mai 1925
Es erhellt, daß diese Aufgabe für den Bearbeiter eine heikle bedeutet, die echte Begeisterung, musikdramatische Begabung, Einfühlungsvermögen, künstlerischen Takt und große Gewissenhaftigkeit erfordert. Ich stehe nun nicht an, dies alles Carl Orff in größerem oder geringerem Maße zuzugestehen; was die Begeisterung und Gewissenhaftigkeit anlangt, so bin ich sicher, daß er dieser in hohem Maße teilhaftig ist. Orff unternahm also den Versuch, zu beseitigen, zu ergänzen, zu verändern in dem Glauben und der Absicht, hierdurch dem Inhalt dieses Werks eine der heutigen Zeit angemessene Form zu geben (inwieweit so etwas überhaupt möglich ist, soll hier unerörtert bleiben), und unterzog das Werk einer durchgreifenden Umgestaltung. Nach den Angaben in dem von Oskar Lang herausgegebenen Einführungsbuch wurden die ursprünglichen fünf Akte zu drei zusammengezogen, einige Personen umgeändert, andere überhaupt weggelassen; der ganze Text wurde neu gedichtet, und auf musikalischem Gebiet wurde neben der erforderlichen, ganz frei durchgeführten Instrumentation und Hinzufügung fehlender Stimmen die Reihenfolge der Stücke geändert, der musikalische Teil jedoch bis auf Ausmerzung einzelner Rezitativteile sonst unangetastet gelassen. Nun liegt aber bei einem derartigen Beginnen der Fall wohl selten so klar, daß man nur gewisse uns veraltet erscheinende Teile weglassen darf, um zur vollen Wirkung zu gelangen, etwa wie man zu diesem Zweck ein altes Gemälde von der im Lauf der Zeiten angesetzten Schmutzschicht befreit, sondern hier ist das Kunstwerk als Ganzes in größerem oder geringerem Maße in allen seinen Teilen enthalten, und darum wird auch fast jede größere Veränderung mehr oder weniger den Sinn des Werkes mitverändern. Es besteht also hier die mögliche Gefahr, daß in ähnlicher Weise, wie unser Körper gewisse Nahrungsstoffe, aus der Verbindung mit andern an sich wertlosen Stoffen gelöst, nicht mehr aufzunehmen vermag, das Kunstwerk bei dem Versuch, seinen Kern von scheinbar lästiger Schale zu befreien, für uns an Wirkungskraft verlöre. Sicher ist nun, daß das Werk in der Orffschen Bearbeitung an Straffheit gewonnen, aber an naiver sinnlicher Frische verloren hat. Bei dem Bestreben zur Erzielung erhabener Wirkung hat man dem Werk alle besonderen Züge genommen und sie durch solche mehr allgemeiner Art ersetzt, wodurch das Werk selbst aber einen bewußten und asketischen Anstrich bekam, und zwar nicht zu seinem Vorteil. So hat Orff beispielsweise die Hirten und Nymphen in Gefährten und Gefährtinnen des Orpheus verwandelt, Charon, der stygische Fährmann, wurde zu einem Höllenwächter allgemeiner Art, die Figur der Hoffnung dagegen, die Orpheus zur Unterwelt geleitet, weiter das Herrscherpaar der Unterwelt, Pluto und Proserpina, sowie Apollo, der ursprünglich am Schluß den Orpheus nach dem Olymp zu entführen hat, wurden kurzerhand entfernt. Die Wirkung ist nun die, daß von einer eigentlichen Handlung wenig mehr wahrnehmbar ist, indem Orpheus zu einem bedeutenden Teil fast allein auf der Bühne steht. Und hier hat Orff entschieden gegen ein musikdramatisches Grundgesetz verstoßen: die Sichtbarmachung der Handlung. Es geht einfach nicht an, den Orpheus einen großen Teil des Abends monologisierend auf die Bühne zu stellen, zudem in der Oper doch sowieso nie alle Worte verstanden werden. Die Strafe folgte dafür auch auf dem Fuße, indem sich am Schluß des Stücks ein Teil der Zuhörer überhaupt nicht klar war, ob das Stück nun eigentlich zu Ende sei. Von der Musik, soweit sie losgelöst von der Gesamtwirkung betrachtet werden kann, ist zu sagen, daß sie stets edel, fast immer interessant und oft von herrlicher Wirkung in ihrer eigenartig-hoheitsvollen, ausdrucksreichen Sprache war.
Die Aufführung zeigte, daß von allen Seiten der gute Wille da war und man sich der neuartigen Aufgabe mit Eifer angenommen hatte; doch darf nicht geleugnet werden, daß die Ausführung noch etwas Unfreies an sich hatte, so wie wenn man sich auf ungewohntem Boden bewegt. Werner v. Bülow leitete sein nicht alltägliches Orchester mit Umsicht, ebenso waren die Solisten, vor allem die Darstellerin des Orpheus (Emilia Poßzert), sichtlich bemüht, ihr Bestes zu geben, aber daß ihnen dieser Stil nicht der vertraute war, war nicht nur an den nicht allzu seltenen Reinheitsschwankungen zu bemerken, denen der singende Chor (a cappella) naturgemäß in noch höherem Maße ausgesetzt war. „Singender Chor“ deshalb, da dieser nicht auf der Bühne stand, sondern fürs Auge durch einen rein pantomimischen vertreten wurde. Die Gründe, die zu dieser Arbeitsteilung führten, sind verständlich, und doch liegt in diesem Zerlegen einer Kollektivpersönlichkeit in einen nur sichtbaren und einen nur hörbaren Teil ein die unmittelbare Wirkung Beeinträchtigendes. Die choreographische Leitung (Dr. Lida Wolkowa) brachte manch feines Gesamtbild zustande, die Bewegungen im einzelnen waren jedoch häufig nicht allzu originell. Die Inszenierung (Richard Meyer-Walden), sowie das Bühnenbild (Heinz Guete) waren den Orffschen Intentionen gut angepaßt.
Am Schluß der Vorstellung spendete nach überwundener anfänglicher Zurückhaltung ein Teil des Publikums lebhaften Beifall, für den sich die Ausführenden und der noch jugendliche Bearbeiter mehrmals bedanken konnten.
Dr. H. E., Neue Musik-Zeitung, 46. Jg., Heft 16, Mai 1925
- Share by mail
Share on