[…] Der Computer, meinte James A. Moorer vom Center for computer research in music and acoustics an der Stanford University in Palo Alto, sei attraktiv, biete so viele Möglichkeiten an, daß er den Menschen dominieren könne. Es müsse ein Ausgleich geschaffen werden zwischen Intuition und technischer Ausrüstung. Moorer und seine Kollegen zweifeln aber nicht daran, daß der Computer in wenigen Jahren als Musikinstrument so populär sein wird, wie es heute schon in der Pop- und Unterhaltungsmusik, in der Live-Elektronik der Synthesizer ist. Drei Monate reichen aus, sagen sie, um sich die nötigen Grundkenntnisse anzueignen; Kenntnisse, die es gestatten, den Computer wie ein konventionelles Instrument zu benutzen. Der Computer kann alle über Lautsprecher überhaupt realisierbaren Klänge herstellen; er leistet also mehr als ein Synthesizer, und er arbeitet vor allem so, daß jeder Klang präzise bis in die kleinste Phase einer Schwingung wiederholbar ist. Die Tendenz geht heute dahin, tragbare Instrumente zu entwickeln, die man zu Live-Aufführungen aufs Podium mitnehmen kann. Sie werden mit Klaviaturen versehen sein, die auf einfache Weise zu bedienen sind; die komplizierten Rechnungen zur Erzeugung der Klänge nimmt das Gerät selbsttätig vor. Heute schon gibt es – noch recht teuer – technische Vorrichtungen, die an Großrechenanlagen angeschlossen werden und in real time, also ohne Zeitverzögerung, Dutzende von unabhängigen Stimmen auf einmal künstlich herstellen oder auch sogenannte natürliche Klänge, von Instrumenten erzeugt, nach Wunsch des Komponisten umgestalten können.

Vor 50 Jahren: „Musik und Computer in den USA“ – eine Veranstaltung in Berlin
Moorer gab eine Einführung in die mathematischen Grundlagen der digitalen mit Ziffernfolgen arbeitenden Klangsynthese und in die Programmierungssprache ,,Fortran˝. Mathematik wurde den Musikern ohne Schrecken nahegebracht. John M. Grey, eben falls aus Stanford, bot einen Schnellkurs in Psychoakustik: zur Debatte standen die Beziehungen zwischen den Klangfarben verschiedener Instrumente sowie zwischen der physikalischen Beschaffenheit eines Klanges und seiner Wahrnehmung; es gilt die Voraussetzungen zu schaffen für die Produktion bis lang noch unbekannter, ja ungeahnter Klänge. Am Hörer sei es, die neuen Klangfarben dann entsprechend seiner persönlichen sinnlichen Erfahrung zu definieren.
John M. Chowning von der Stanford University ist einer der bedeutendsten Musiker und Forscher aus der Schule von Max Mathews und Jean-Claude Risset, den beiden Bahnbrechern der Klangsynthese. Er betont immer wieder, daß es darauf ankäme, den Computer zu entmystifizieren, den Bereich der sinnlosen Abstraktionen zu verlassen. Programmieren sei für Musiker leichter erlernbar als etwa die Kontrapunkt-Regeln des 16. Jahrhunderts. Chowning bestätigte meine Vermutung, daß nach einer Phase des Experimentierens und des Klangtests die Wege für eine computereigene Musik offenstehen. Dabei spielt die integrierende Fähigkeit der Computersprachen eine hervorragende Rolle: untergeordnete Strukturen können so errechnet werden, daß sie musikalischen Eigenwert besitzen und dennoch jederzeit auf die Werkgestalt im ganzen beziehbar sind. Natürliche, instrumentale Klänge sind das Modell, denn es hat sich gezeigt, sagt Chowning, daß die bisherige elektronische Musik das Ohr des Hörers nicht in gleicher Weise zu fesseln vermochte. So wurde an der Stanford University die Zusammensetzung der Instrumental-Klänge erforscht, um deren Reizwirkung dem unermeßlichen Spektrum künstlicher Klänge nutzbar zu machen; mit der gleichen Zielsetzung hat man das Verhalten von Klängen im Raum untersucht – Veränderungen durch die Entfernung, durch Wechsel in der Geschwindigkeit und im Einfallswinkel. All diese Modifikationen werden in der Computermusik als fixierte Werte – als sogenannte Parameter – in die Komposition eingebracht.
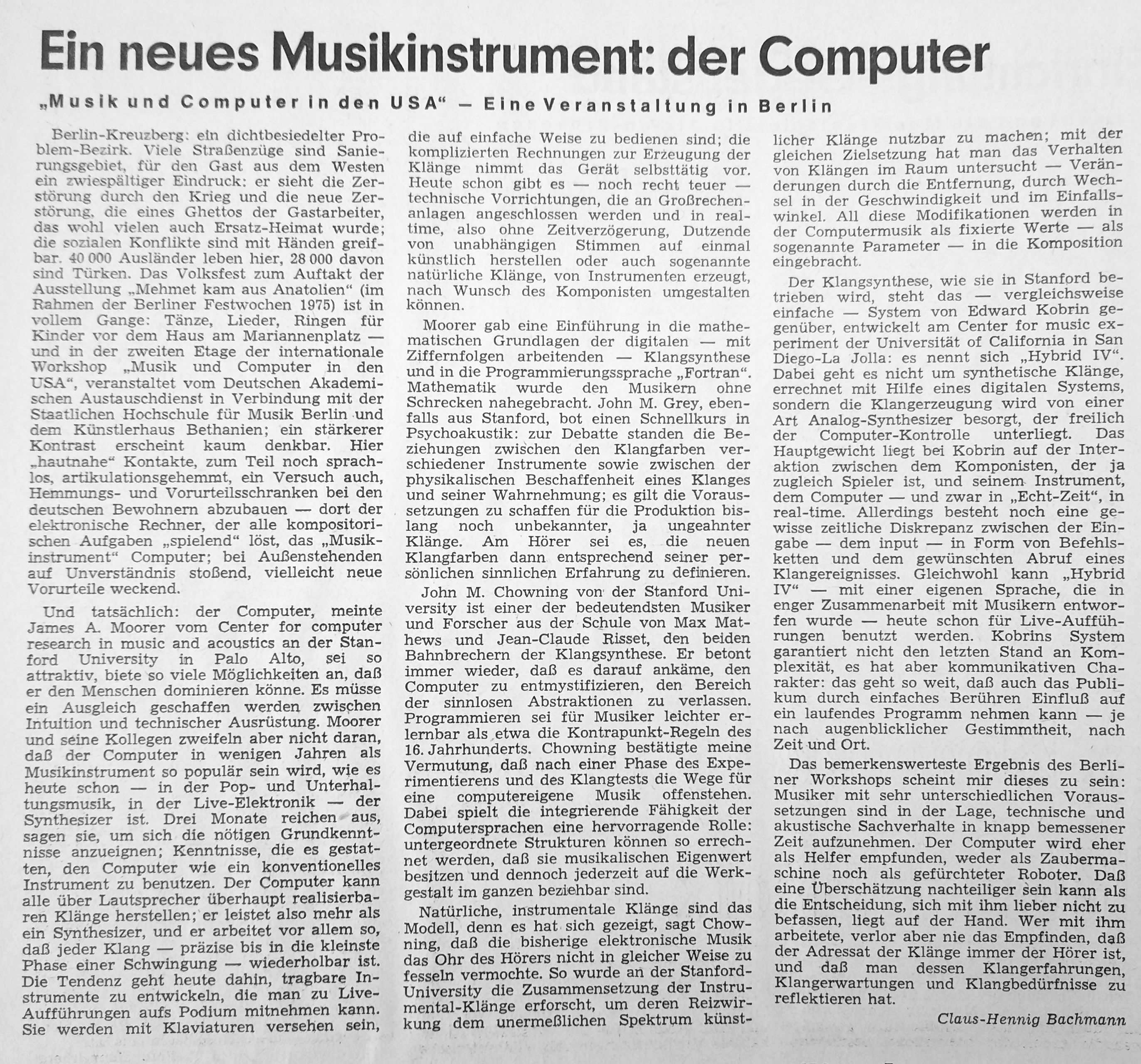
Vor 50 Jahren: „Musik und Computer in den USA“ – eine Veranstaltung in Berlin
Der Klangsynthese, wie sie in Stanford betrieben wird, steht das vergleichsweise einfache System von Edward Kobrin gegenüber, entwickelt am Center for music experiment der Universität of California in San Diego-La Jolla: es nennt sich „Hybrid IV“. Dabei geht es nicht um synthetische Klänge, errechnet mit Hilfe eines digitalen Systems, sondern die Klangerzeugung wird von einer Art Analog-Synthesizer besorgt, der freilich der Computer-Kontrolle unterliegt. Das Hauptgewicht liegt bei Kobrin auf der Interaktion zwischen dem Komponisten, der ja zugleich Spieler ist, und seinem Instrument, dem Computer und zwar in „Echt-Zeit“, in real-time. Allerdings besteht noch eine gewisse zeitliche Diskrepanz zwischen der Eingabe, dem input in Form von Befehlsketten, und dem gewünschten Abruf eines Klangereignisses. Gleichwohl kann „Hybrid IV“ mit einer eigenen Sprache, die in enger Zusammenarbeit mit Musikern entworfen wurde, heute schon für Live-Aufführungen benutzt werden. Kobrins System garantiert nicht den letzten Stand an Komplexität, es hat aber kommunikativen Charakter: das geht so weit, daß auch das Publikum durch einfaches Berühren Einfluß auf ein laufendes Programm nehmen kann – je nach augenblicklicher Gestimmtheit, nach Zeit und Ort.
Das bemerkenswerteste Ergebnis des Berliner Workshops scheint mir dieses zu sein: Musiker mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen sind in der Lage, technische und akustische Sachverhalte in knapp bemessener Zeit aufzunehmen. Der Computer wird eher als Helfer empfunden, weder als Zaubermaschine noch als gefürchteter Roboter. Daß eine Überschätzung nachteiliger sein kann als die Entscheidung, sich mit ihm lieber nicht zu befassen, liegt auf der Hand. Wer mit ihm arbeitete, verlor aber nie das Empfinden, daß der Adressat der Klänge immer der Hörer ist, und daß man dessen Klangerfahrungen, Klangerwartungen und Klangbedürfnisse zu reflektieren hat.
Claus-Henning Bachmann, Neue Musikzeitung, XXIV. Jg., Nr. 5, November 1975
- Share by mail
Share on