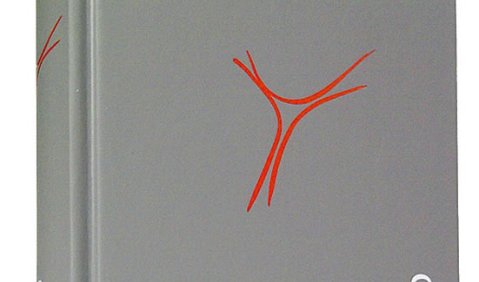Es sollte den Gemeindegesang entstauben - zumindest ein bisschen. Vor zehn Jahren bekamen die Katholiken in Deutschland und Österreich ein neues Buch fürs Singen und Beten im Gottesdienst. Ultra-modern freilich war es schon damals nicht.
Bamberg - Das wohl bekannteste Lied findet sich unter Nummer 249, auf Seite 340. Der Weihnachtsklassiker schlechthin, «Stille Nacht, Heilige Nacht», ist natürlich drin geblieben im neuen Gesang- und Gebetbuch Gotteslob, das die katholische Kirche in Deutschland und Österreich vor genau zehn Jahren eingeführt hat.
Am ersten Adventssonntag 2013 zogen in die Gottesdienste modernere Töne ein. Zumindest einige. Denn klassisches Kirchenliedgut ist immer noch stark vertreten auf den mehr als 1000 Seiten. Thomas von Aquins (1225-1274) lateinischer Hymnus «Pange lingua» etwa oder «Lobet den Herrn», mit dem immer noch viele Gottesdienste beginnen.
Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre lasse sich sagen, dass eine «wirklich gute Mischung gelungen ist», sagt der Vorsitzende der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Stephan Ackermann aus Trier. «Nicht wenige Lieder und Gesänge im Gotteslob verbinden uns mit einer jahrhundertealten Tradition, und häufig sind sie in unserem Kulturschatz fest verankert. Darauf lässt sich nicht gut verzichten.»
Die Gesamtauflage des Gotteslobs liegt nach DBK-Angaben bei rund sieben Millionen. Damit hat bei weitem nicht jeder Katholik ein Exemplar zu Hause, denn noch gehören knapp 21 Millionen Menschen in Deutschland der katholischen Kirche an.
«Sicher wird man längst nicht in jedem katholischen Haushalt ein Gotteslob finden, aber das Interesse war und ist ausgesprochen groß», sagt Ackermann. Und «ein eigenes Gotteslob zur Erstkommunion zu schenken, ist nach wie vor guter Brauch.»
Das Buch, das neben Gesängen auch Gebete und Infos zu den Sakramenten enthält, werde gut angenommen. «Angesichts so massiver Veränderungen und Umbrüche, wie wir sie als Kirche und in der Gesellschaft gerade erleben, ist das keine Selbstverständlichkeit.»
Maximilian Pöllner, Sprecher des Bundesverbandes katholischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Deutschlands (BKKD), findet: «Jedem Geschmack gerecht zu werden, ist natürlich unmöglich, doch die Kompromisse sind meines Erachtens recht gut gelungen.»
Traditionelle Kirchenlieder wurden ergänzt durch Lieder, die der Bewegung «Neues Geistliches Lied» (NGL) entsprungen sind, also deutlich moderner klingen als Gesänge aus früheren Jahrhunderten. Die Kirchenmusik entwickelt sich nach Experten-Ansicht dennoch schnell weiter. «Das Gotteslob bildet nicht ab, was sich gerade tut. Es ist die Kanonisierung der etablierten Kirchenmusik», sagt Tobias Lübbers, Leiter der «Werkstatt Neues Geistliches Lied (NGL)» im Erzbistum Bamberg. Dass sich im Gotteslob nun auch Lieder der christlichen Popularmusik finden, zeige, dass die Publikation stilistisch offen war.
Inzwischen werden Gotteslob-Lieder mit dem Label «neu» häufig bei Gottesdiensten zur Goldenen Hochzeit gewünscht. «Das hat Glaubensbiografien geprägt» - und klinge heute aber für das junge Publikum vielleicht bieder und altbacken. Religiöse Prägung funktioniere jedoch sehr stark auch über Musik, sagt Lübbers. «Musik klingt fort, sie kann sehr tief wirken.»
Christliche Popularmusik habe stets aktuelle Trends aufgegriffen. «Die Musik entwickelt sich weiter, das ist auch gut so.» Ziel müsse es sein, «anschlussfähig» zu bleiben, zu erfassen, was die Menschen musikalisch mögen, «die Hörgewohnheiten aufzusammeln». Christliche Popularmusik solle so klingen, dass die Menschen musikalisch damit vertraut sind. «Up to date zu sein, ist nichts Unchristliches», so Lübbers. Sakral gelte oft nur Musik, die «alt» sei - das sei aber früher nicht so gewesen: Bach sei auf der Höhe seiner Zeit gewesen. «Musik verändert sich. Wir sind gewillt, am Puls der Zeit zu bleiben.»
Nach Beobachtung des Kirchenmusiker-Verbandes sind in den täglichen Gottesdiensten die schon lange etablierten Lieder die beliebtesten: «Die Lieder, die am kräftigsten gesungen werden, sind die altbekannten Gassenhauer», berichtet ein Sprecher. «Unsere Zielgruppe ist zumeist eher älter, Gewohntes und Bekanntes wird gerne genommen. Natürlich darf und muss dazwischen auch was Neues kommen.»
Das Singen sei seit «jeher untrennbar mit christlicher Liturgie verbunden», betont Bischof Ackermann. «Dabei hat der Gemeindegesang, wie er bei uns üblich ist, nichts Übermächtigendes an sich. Wie ich mitsinge, ob ich mitsinge, bleibt mir selbst überlassen, und das muss möglich sein.» Dennoch wirbt er fürs Mitsingen, egal ob geübt oder nicht. «Wenn da nicht jeder Ton sitzt, ist das absolut in Ordnung. Ich finde es immer schade, wenn sich da jemand zurückzieht, obwohl er viel lieber mitsingen würde.»
Die Nummer 249 («Stille Nacht») übrigens wird trotz ihrer Popularität nur einmal im Jahr im Gotteslob aufgeschlagen - am Schluss der Christmette am 24. Dezember. Denn das ist die ultimative «Heilige Nacht» nach katholischem Verständnis. Egal, wie oft die berühmten Töne vorher über die Weihnachtsmärkte geweht sind.