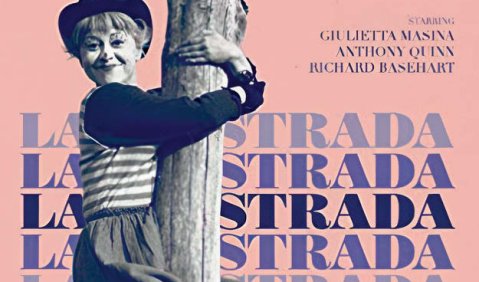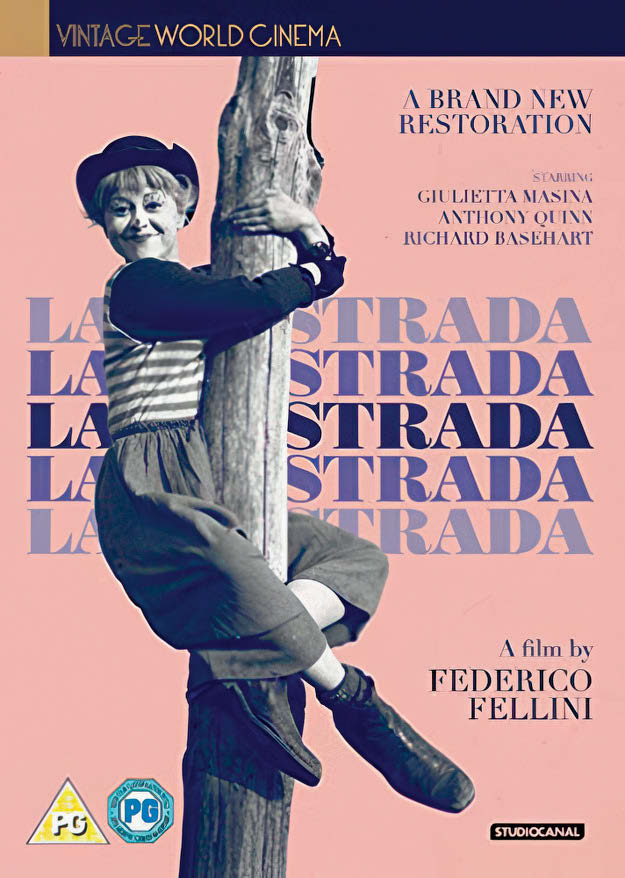Schon in den ersten Tonfilmen wurde wie in Hollywood, Paris, Wien oder Berlin gesungen. Besonders charmant ist, wie der blutjunge Vittorio De Sica in Camerinis „Gli uomini, che mascalzoni“ (1932) in einem Lokal zu den Klängen eines elektrischen Klaviers seine Angebetete ansingt. Ein geliebter Schuft, der ein Jahrzehnt später als Regisseur den Neorealismus entscheidend mitprägen sollte, mit Klassikern wie „Fahrraddiebe“ oder „Schuhputzer“. Und später dann selbst auf der Leinwand angesungen werden wird von den großen Sexikonen des italienischen Kinos: Gina Lollobrigida und Sophia Loren. Die Loren war es dann auch, die in der Hollywood-Komödie „Es geschah in Neapel“ ihren ganz großen Gesangsauftritt hatte, mit dem „Americano“-Song, der in den Nullerjahren „modernisiert“ zum Hit wurde. Die „Mutter“ all dieser „Nummern“ ist freilich Silvana Manganos erotischer Tanz zu „El Negro Zumbon“ in dem Melodrama „Anna“, komponiert von Armando Trovajoli, der bis zu seinem Tod 2013 die Musik für über 200 Filme lieferte.
Trovajoli gehörte zu einer Garde von „genialen“ Handwerkern, die seit den fünfziger Jahren das italienische Kino mit sinfonischen, „exotischen“ oder jazzigen Scores orchestrierten: Mario Nascimbene, Angelo Francesco Lavagnino, Piero Umiliani (der Chet Baker ins Studio holte), Piero Piccioni oder Carlo Rustichelli. Eine Sonderstellung nimmt natürlich Nino Rota ein, der Hausmusikus des großen Zampanos Fellini. Rota & Fellini, das waren die „Unzertrennlichen“ des Italo-Kinos. Ein Kino-„Pärchen“ wie Hitchcock & Herrmann oder Truffaut & Delerue. Immer traf Rota seit „La Strada“ intuitiv den „Ton“ der filmischen Fellini-Welten. Wer an Fellini denkt, hört zuerst Zirkusklänge, Lehar-Walzer, „Stormy Weather“ und all die anderen Volkslieder und sehnsüchtigen Melodien, die Rota miteinander zum „Fellini-Sound“ verschmolzen hat. Ein „Sound“, der später auch viele Jazzmusiker zu Hommagen inspirieren sollte. „Amarcord“ hieß Anfang der 80er das erste Tribute-Album, das der geniale Produzent Hal Willner Rota & Fellini widmete. Mit dabei: Carla Bley, Michael Mantler, Bill Frisell, Steve Lacy oder Deborah Harry. Ein Projekt, das neues Interesse weckte an den Rota-Fellini-Soundtracks für „Otto e mezzo“ oder „La dolce vita“.