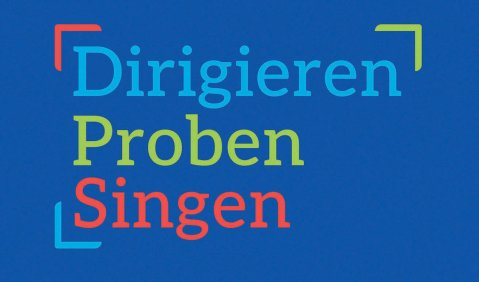Demokratiebildung und Pluralitätstraining
Kassandrarufe über unser Bildungssystem sind eigentlich genug gesprochen. Allseits bekannt, aber gleichzeitig auch verschrien, ignoriert und marginalisiert wurde die Seherin, sodass erst ein ABBA-Song eine längst...