[…] Unter den vorliegenden Werken gebührt Paul Hindemith zweifellos der erste Platz. Denn sowohl mit seinem IV. Streichquartett (op. 32) wie auch mit dem Trio (op. 34), vor allem aber mit der Kammermusik No. 2 (op. 36, No. 1) löst der Komponist instrumentale Versprechungen ein, wie man sie nur von ihm erwarten durfte.

Neue Musik-Zeitung – Vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Neue Kammermusik (Paul Hindemith)
Zumal dies „Klavier-Konzert“, das ebenso wie die beiden andern Schöpfungen im Verlag von B. Schott's Söhne, Mainz, erschienen ist, offenbart das Gestaltungsproblem der jüngsten Musik nicht nur in absolutem Sinne, sondern zugleich höchst vital und naturhaft. Schon die Besetzung betont den Charakter der reinen Spielmusik: Zu Flöte, Oboe, Klarinette und Baßklarinette, Fagott, Horn, Trompete und Posaune treten nur je eine Violine, Bratsche, Violoncell, Kontrabaß, das Klavier wird weniger brillant solistisch denn als obligates, originell zweistimmiges Instrument verwendet, somit entsteht ein durchaus eigenartiges, zuweilen bewußt archaisierendes Musizieren. Der Eindruck edelster Sachlichkeit und diskreter Durchsichtigkeit ist schon beim Lesen der Partitur so vorherrschend, daß man ohne weiteres versteht, warum dies Werk manchen Hörern, die in Hindemith bislang nur einen Instinktmusiker sahen, nicht sofort einging.
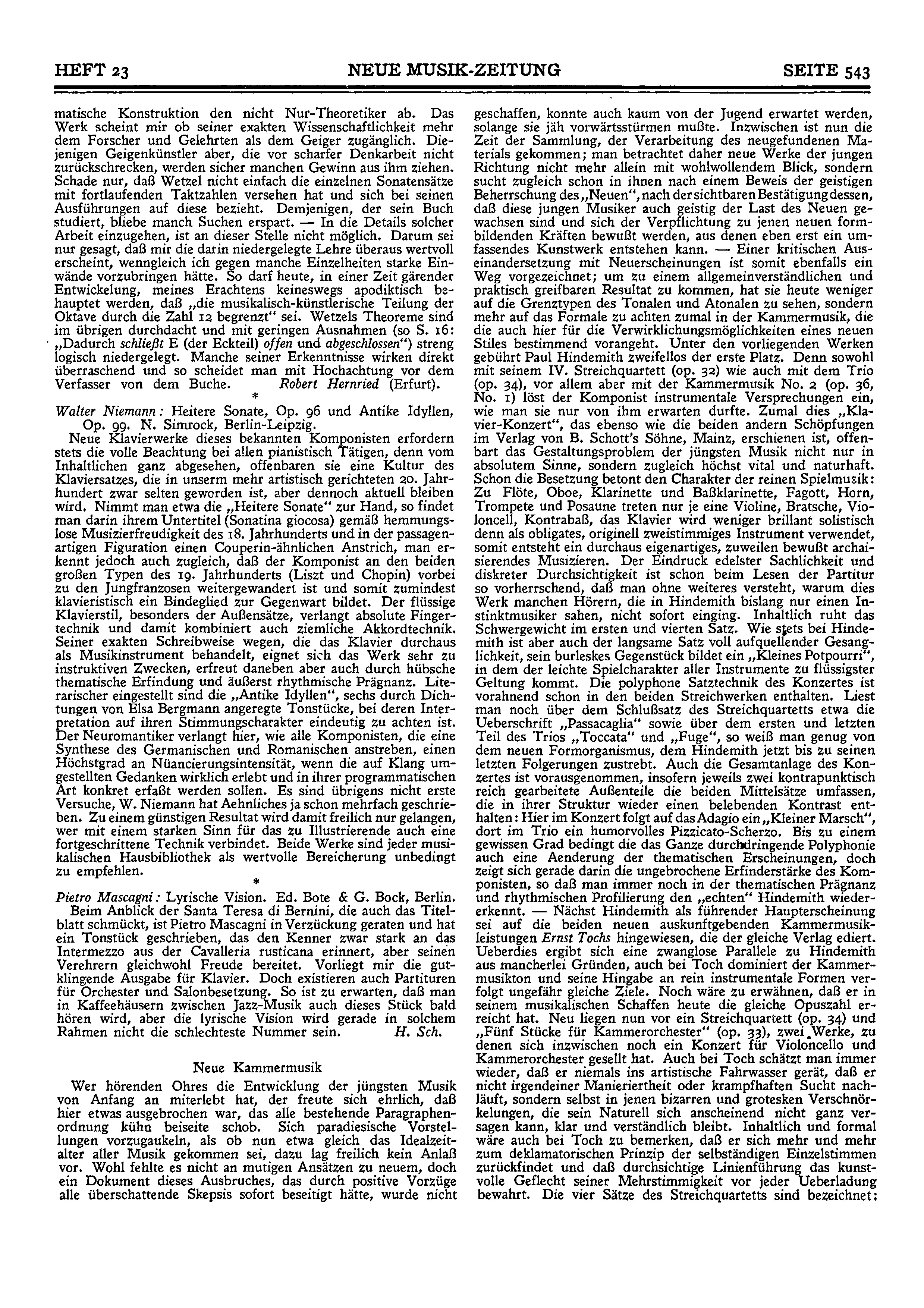
Vor 100 Jahren: Neue Kammermusik (Paul Hindemith)
Inhaltlich ruht das Schwergewicht im ersten und vierten Satz. Wie stets bei Hindemith ist aber auch der langsame Satz voll aufquellender Gesanglichkeit, sein burleskes Gegenstück bildet ein „Kleines Potpourri“, in dem der leichte Spielcharakter aller Instrumente zu flüssigster Geltung kommt. Die polyphone Satztechnik des Konzertes ist vorahnend schon in den beiden Streichwerken enthalten. Liest man noch über dem Schlußsatz des Streichquartetts etwa die Ueberschrift „Passacaglia“ sowie über dem ersten und letzten Teil des Trios „Toccata“ und „Fuge“, so weiß man genug von dem neuen Formorganismus, dem Hindemith jetzt bis zu seinen letzten Folgerungen zustrebt. Auch die Gesamtanlage des Konzertes ist vorausgenommen, insofern jeweils zwei kontrapunktisch reich gearbeitete Außenteile die bei den Mittelsätze umfassen, die in ihrer Struktur wieder einen belebenden Kontrast enthalten: Hier im Konzert folgt auf das Adagio ein „Kleiner Marsch“, dort im Trio ein humorvolles Pizzicato-Scherzo. Bis zu einem gewissen Grad bedingt die das Ganze durchdringende Polyphonie auch eine Aenderung der thematischen Erscheinungen, doch zeigt sich gerade darin die ungebrochene Erfinderstärke des Komponisten, so daß man immer noch in der thematischen Prägnanz und rhythmischen Profilierung den „echten“ Hindemith wiedererkennt. […]
Prof. Hans Schorn, Neue Musik-Zeitung, 46. Jg., Heft 23, September 1925
- Share by mail
Share on