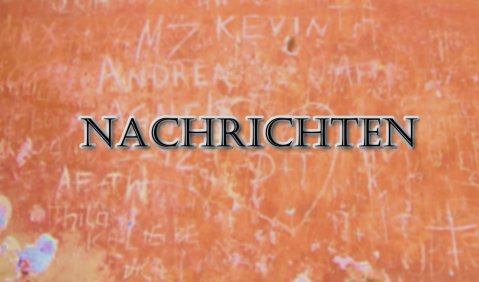Seit 2009 ist der Tango Weltkulturerbe. Er gilt heute als Nationalheiligtum Argentiniens, doch eine Erfindung aus Sachsen gab ihm seine Seele. Daran wird im aktuellen Kulturhauptstadtjahr angeknüpft.
Er ist das Aushängeschild der Musik Südamerikas, steht für Leidenschaft, Melancholie und Schmerz: der Tango. Mit zahlreichen Milongas, so werden Tango-Tanzveranstaltungen genannt, und Konzerten wird er 2025 auch im Chemnitzer Kulturhauptstadtprogramm gefeiert. Doch was hat der Tango mit Chemnitz und Sachsen zu tun? Sehr viel, sagen Experten. Denn hiesige Instrumentenbauer haben an seiner Geschichte und dem unverwechselbaren Klang dieser Musik mitgeschrieben.
Die Spurensuche führt zum Karl-Marx-Monument im Chemnitzer Stadtzentrum. Gleich hier soll sie gestanden haben, die Wiege der Concertina - jenes Instrument, das über die Jahre zum Bandoneon weiterentwickelt wurde. Ihr Erfinder: Carl Friedrich Uhlig. «Er war ein typischer Chemnitzer Macher», sagt der Vorstand und künstlerischer Leiter der Sächsischen Mozart-Gesellschaft, Franz Wagner-Streuber. Aus der Textilindustrie kommend habe sich Uhlig mit viel Erfindergeist daran gemacht, ein Instrument zu schaffen, dass von jedem leicht gespielt werden konnte.
Das war 1834. Das viereckige Instrument hatte zunächst nur fünf Knöpfe auf jeder Seite. Doch der Tonumfang wurde in den folgenden Jahren stetig erweitert. Jede Taste hat dabei zwei Töne - welcher erklingt, hängt davon ab, ob der Balg aufgezogen oder zugedrückt wird. Das wird Wechseltönigkeit genannt. Besonders forciert wurde die Erweiterung von Uhligs Mitarbeiter Carl Friedrich Zimmermann, der später in Carlsfeld im Erzgebirge einen eigenen Betrieb aufbaute. Ein Tango-Bandoneon hat in der Regel 142 Töne.
Auswanderer bringen Bandoneon nach Südamerika
Die Instrumente fanden weite Verbreitung, hierzulande vor allem in Arbeiterkreisen. Sie wurden deswegen auch Bergmannsklavier genannt. Auswanderer brachten sie schließlich nach Südamerika, wo sie auf den Tango trafen. «Den Tango gab es schon, aber das Bandoneon hat ihn mit seinem unverwechselbaren Klang total verändert», weiß Jürgen Karthe.
Der Dresdner ist ein gefragter Bandoneon-Spieler und lehrt das Instrument. 2024 hat er ein Buch zur Geschichte des Bandoneons veröffentlicht. Dessen Wiege steht zwar in Sachsen, Namensgeber wurde aber der Musiker und Instrumentenhändler Heinrich Band aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Neuere Recherchen und Forschungen belegten, dass Zimmermann schon vor Band «um 1843 die mehrreihige Concertina erfunden hatte und sie «Union-Harmonika» nannte, welche später als Bandoneon um die ganze Welt ging», schreibt Karthe in seinem Buch.
Und Sachsens Instrumentenbauer entwickelten das Bandoneon zur Perfektion. Besonderen Ruhm erlangten die Instrumente von Ernst Louis Arnold (ELA) und Alfred Arnold (AA) aus Carlsfeld. «Das sind die Stradivaris unter den Bandoneons», erläutert Wagner-Streuber. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie Zehntausende davon nach Südamerika exportiert.
Instrumentenbau in aufwendiger Handarbeit
Wie Sachsen mit seinem Instrumentenbau den Tango prägte, will das Projekt «Bewegende Klänge - Concertina & Bandoneon» der Mozart-Gesellschaft im Kulturhauptstadtjahr zeigen. Das Angebot reicht von einer Ausstellung und einem Festival über regelmäßige Konzerte und Milongas bis hin zu einer thematischen Stadtführung. Zudem erhalten Schüler Bandoneon-Unterricht. «Die Krönung wäre für mich, wenn an dem Standort der Werkstatt Carl Friedrich Uhligs künftig ein Denkmal entstünde», erklärt Wagner-Streuber. Zumindest eine Gedenktafel wird seinen Worten zufolge im September enthüllt.
Und Sachsens Instrumentenbauer? Drei Firmen gibt es laut Karthe in Carlsfeld und Klingenthal aktuell im Freistaat, die sich dem Bandoneon verschrieben haben. Eine davon ist die «Bandonion & Concertinafabrik Klingenthal». 50 bis 70 Instrumente werden in der Manufaktur mit drei Mitarbeitern jedes Jahr gefertigt - alles in Handarbeit, wie Gründerin Anja Rockstroh erzählt.
Vorbild seien die legendären Instrumente Alfred Arnolds. Jedes besteht den Angaben zufolge aus mehr als 1.800 Teilen - vom Balg bis zur Stimmplatte, von den Tasten bis zu den belederten Ventilklappen. «Wir produzieren nur auf Bestellung, jedes Instrument ist ein Einzelstück.» Von Klingenthal aus gehen die Instrumente auch heute wieder in alle Welt - «viel in europäische Länder wie Frankreich, Spanien, Italien, aber auch bis nach Korea und China».