Genau zweihundert Jahre nach ihrem Erstehen erlebte diese von musikalischen Schönheiten strotzende Händelsche Oper ihre deutsche Uraufführung. Allerdings in einem unsren Tagen nach Möglichkeit angepaßten Gewand, ein Gewand, das aber trotz allen redlichen Bemühungen nicht recht sitzen will. Hermann Roth und Anton Rudolph, die Erwecker der Mozartschen Jugendopern, haben es zugeschnitten. Dieser ist der Urheber des deutschen Textes, jener hat der Musik eine andere Form gegeben. Der Sinn der Handlung wurde durchaus beibehalten.

Neue Musik-Zeitung – Vor 100 Jahren
Vor 100 Jahren: Georg Friedrich Händel: „Tamerlan“. Uraufführung am Landestheater in Karlsruhe
Bajazet, der Türkenkaiser, ist nach einer verlorenen Schlacht mit seiner Tochter in die Gefangenschaft seines mächtigen Gegners, des Tartarenfürsten Tamerlan, geraten. Der Griechenfürst Andronikus, ein Verbündeter Tamerlans, bestimmt seine Braut Asteria, die Tochter Bajazets, den Herrscher um die Freiheit ihres Vaters zu bitten. Bei dieser Gelegenheit entbrennt Tamerlan in heftiger Liebe für die schöne Asteria und begehrt sie zur Gattin, trotzdem er ein Verlöbnis mit der Fürstin von Trapezunt, Irene, bereits eingeleitet hat. Mißverständnisse, Intrigen beschwören nun ein ganzes Heer konstruierter Verwirrungen herauf. Asteria glaubt sich von ihrem Verlobten verraten, nimmt die Werbung Tamerlans an in der heimlichen Absicht, ihn in der Brautnacht zu töten. Bajazet ist zu stolz, um seine Freiheit um diesen Preis anzunehmen, verstößt sein Kind und lehnt die gebotene Bruderhand Tamerlans ab. Irene macht ihre Rechte geltend. Asterias Racheplan wird aufgedeckt, Bajazet vergiftet sich, um der weiteren Erniedrigung durch Tamerlan zu entgehen, dieser, durch den Tod des Stolzen erschüttert, entläßt Asteria und ihren Verlobten aus seinem Lande und vermählt sich mit Irene. Diese verworrene Handlung unserem heutigen Empfinden näher zu rücken, ist keine leichte Aufgabe. Anton Rudolph kam mit einem gewissen Glück der Lösung nahe, obwohl mir scheinen will, als ob die oft gar modernen Redewendungen nicht immer zu dem würdig-strengen Stil der Händelschen Musik passen wollten. Roths Arbeit bestand in einer vollkommenen Neugestaltung der Secco-Rezitative. In ihnen spielt sich ja die Handlung ab und den beiden Autoren ist es gelungen, Momente von stark dramatischer Schlagkraft zu erreichen, doch immer erkauft mit einem kleinen Seitensprung aus der eigentlichen Händelschen Linie. Die Arienreihe, aus der die ganze Oper besteht, ist eine Kette von unsagbaren Schönheiten. Und doch vermißt unser heutiges Ohr den lebegebenden Faktor, das Ensemble. Roth hat, um den Fluß der Handlung nicht allzusehr zu hemmen, an den Arien meist das Da capo und ab und zu sogar den Mittelsatz gestrichen. Ich halte dies für keinen Fehler, es mußten Opfer gebracht werden, um auf der andern Seite Erträglichkeit zu erzielen. Bewegen sich die Arien ganz in der überlieferten Form, so hat sich der Dramatiker Händel ein unsterbliches Denkmal mit der musikalischen Gestaltung der Sterbeszenen Bajazets gesetzt. Ein mit Orchester begleitetes Rezitativ, zum Arioso hinneigend, wirkt in seiner schlichten und doch kühnen Harmonik und dem phantasievollen und doch linearen Aufbau so faszinierend, daß ich im Sinne an ein anderes Beispiel in der Opernliteratur erinnert wurde, an das Erscheinen des Komturs in Mozarts Don Juan. Hier wie dort liegen Wurzeln zum künftigen Musikdrama, hier wie dort redet das Genie, das über seine Zeit hinauswächst, seine Sprache. Um dieser Szene willen lohnt sich die Wiedergeburt der „Oper“ Tamerlan, ohne sie hätte es eine gelegentliche Aufführung der Arien im Konzertsaal auch getan; der Musikfreund hätte genau so seine Freude an der blühenden Melodik und dem kräftigen Rhythmus der Händelschen Kunst gehabt. Ob der Durchschnitts-Theaterbesucher auch seine Freude hat, bezweifle ich trotzdem. Händelsche Opern werden immer eine Delikatesse für solche bleiben, die imstande sind, ihre Begriffe von dramatischer Kunst auf eine ganz andere Basis zu stellen; es gehört für uns Heutige eine starke Dosis Selbstverleugnung dazu, die Langstieligkeiten der Handlung über uns ergehen zu lassen.
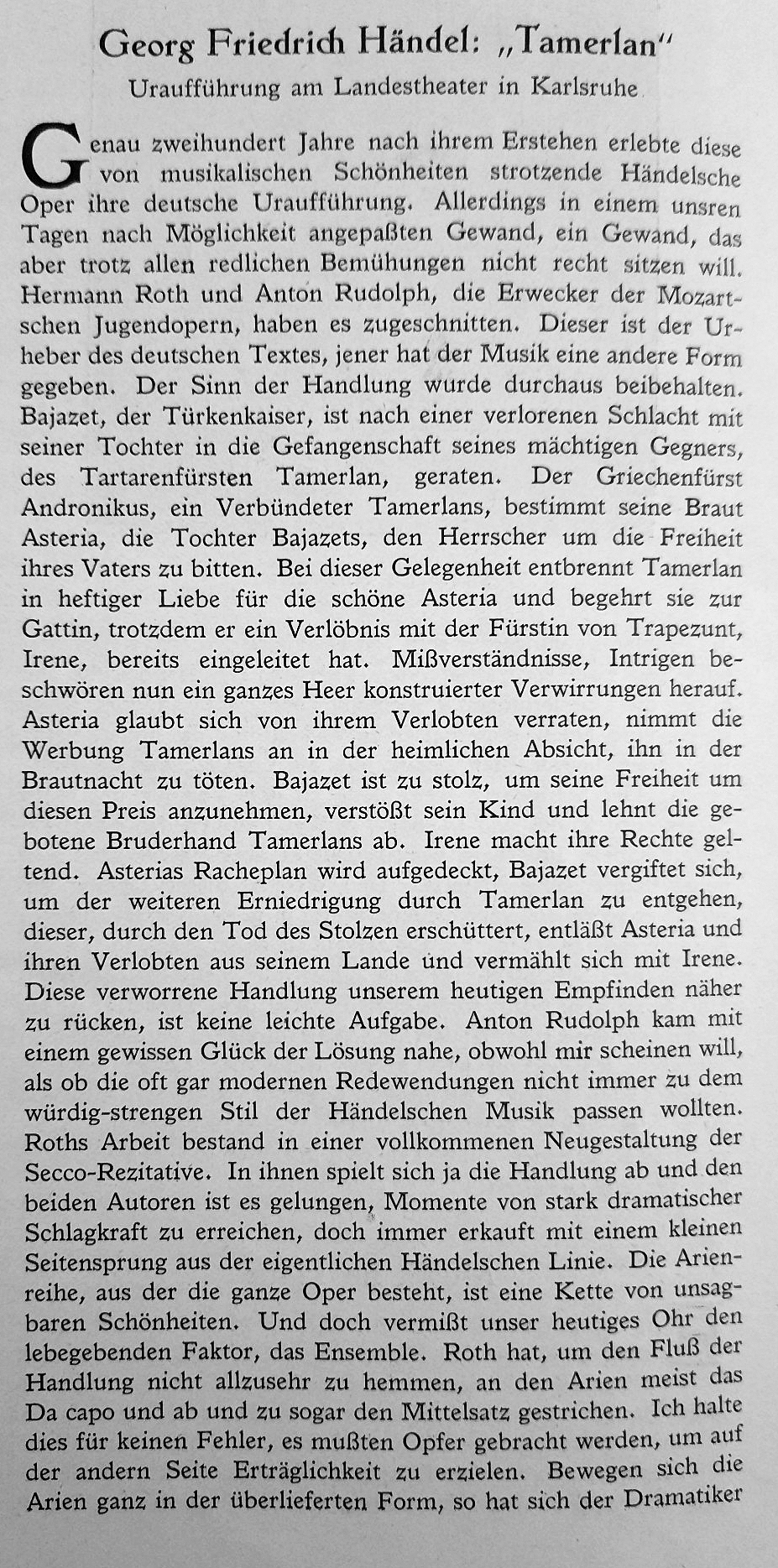
Vor 100 Jahren: Georg Friedrich Händel: „Tamerlan“. Uraufführung am Landestheater in Karlsruhe
Die Aufführung war aufs sorgfältigste vorbereitet. Operndirektor Cortolezis dirigierte mit großem Verständnis für den Stil des Werkes, Intendant Volkner wußte als Regisseur durch streng symmetrische Einteilung der Bewegungen auf der Bühne höchste Konzentration zu erzielen und Direktor Burkard hatte gigantische Bühnenbilder gestellt. Die fünf handelnden Personen hatten durchaus würdige Vertreter gefunden. Als besonders den Händel-Stil erfassend traten Dr. Hermann Wucherpfennig (Tamerlan), Viktoria Hoffmann-Brewer (Andronikus) und Hedy Iracema-Brügelmann (Irene) hervor.
Margarete Voigt-Schweikert, Neue Musik-Zeitung, 46. Jg., 2. Oktober-Heft 1925
- Share by mail
Share on