„Mare nostrum" ist wieder ein echter Kagel: Musiktheater als intellektuelles Vexierspiel voller verfremdeter Realitätspartikel. Ein Stück für zwei Sänger und sechs Instrumentalisten über das Mittelmeer. Die Sprachelemente benutzen ein synthetisches Gastarbeiterdeutsch, dessen lautliche und syntaktische Fehlleistungen nach Arno Schmidtschem Muster zu vielfältigen Assoziationen anregen. Die szenischen Aktionen bleiben rudimentär. Das Modell eines „Musik theaters im Sitzen“ wird erst gegen Schluß aufgebrochen, wenn der Contratenor John Patrick Thomas sich als Beduinenmädchen verkleidet und von dem - wohl für europäisch-amerikanischen Imperialismus einstehenden – Bariton John Bröcheler symbolisch ermordet wird.

Vor 50 Jahren: Kagels „Mare nostrum“ bei den Berliner Festspielen
Kagels Thema ist in diesem Stück die Überwältigung der Machtlosen durch die Mächtigen. Der Komponist meint offenbar, Macht sei überhaupt von Übel, korrumpiere moralisch immer. So spekuliert er darüber, daß etwa die Indianer, hätten sie die „Macht“ gehabt, genauso ihre Gegner versklavt und ausgerottet hätten wie die Weißen. Die Konquistadoren und Kolonisatoren waren aber nicht bloß stärkere „Wölfe“ als die Menschen, die sie entdeckten, sondern kamen aus einem ökonomisch und ideologisch expandierenden Kulturzusammenhang. Wirtschaft, Politik und Religion drängten gleichermaßen nach Welt eroberung. „Macht“ ist also nicht trennbar von den Bedingungen, durch die sie hervorgebracht wird. Sozialdarwinistische Überlegungen greifen dabei nicht.
Kagels spielerischer Umgang mit Ideologie sorgt allerdings dafür, daß es auch in „Mare nostrum“ nicht zu eindeutigen Identifizierungen oder Aussagen kommt. Das Stück beginnt die zeitgenössischen Schilderungen der spanisch-portugiesischen Eroberung Südamerikas aus der Sicht der Eroberten. Bruchlos gleitet die „Handlung“ hinüber in die chiffrierte Andeutung aktueller israelisch-arabischer Konflikte. Als musikalische Manifestation der türkisch-arabischen Welt benutzt Kagel raffiniert orientalisierte Wendungen aus dem „Alla turca“ der Mozartschen A-Dur-Klaviersonate. Eine witzige Huldigung an Mozart, zugleich ein neuer Hinweis auf Kagels augenzwingernde Ehrfurcht gegenüber Meistern der Vergangenheit, ist auch der Heranzug grotesk abgewandelter Dialogfetzen aus der „Entführung aus dem Serail“. Die Text-Musikbeziehungen bleiben stets locker und „offen“; das 80minütige Stück verdichtet sich wohlweislich nirgends zur politischen Parabel, wahrt stets einen surrealistisch-phantasmagorischen und kulinarischen Kunstcharakter. So gehörte es gewiß zum Kompositionsplan, daß das im Berliner Musikhochschulsaal liebevoll aufgebaute, die mittelmeerischen Konturen frei nachgestaltende Wasserbassin bei entsprechender Beleuchtung erlesene Reflexe auf die weiße Wandfläche warf.
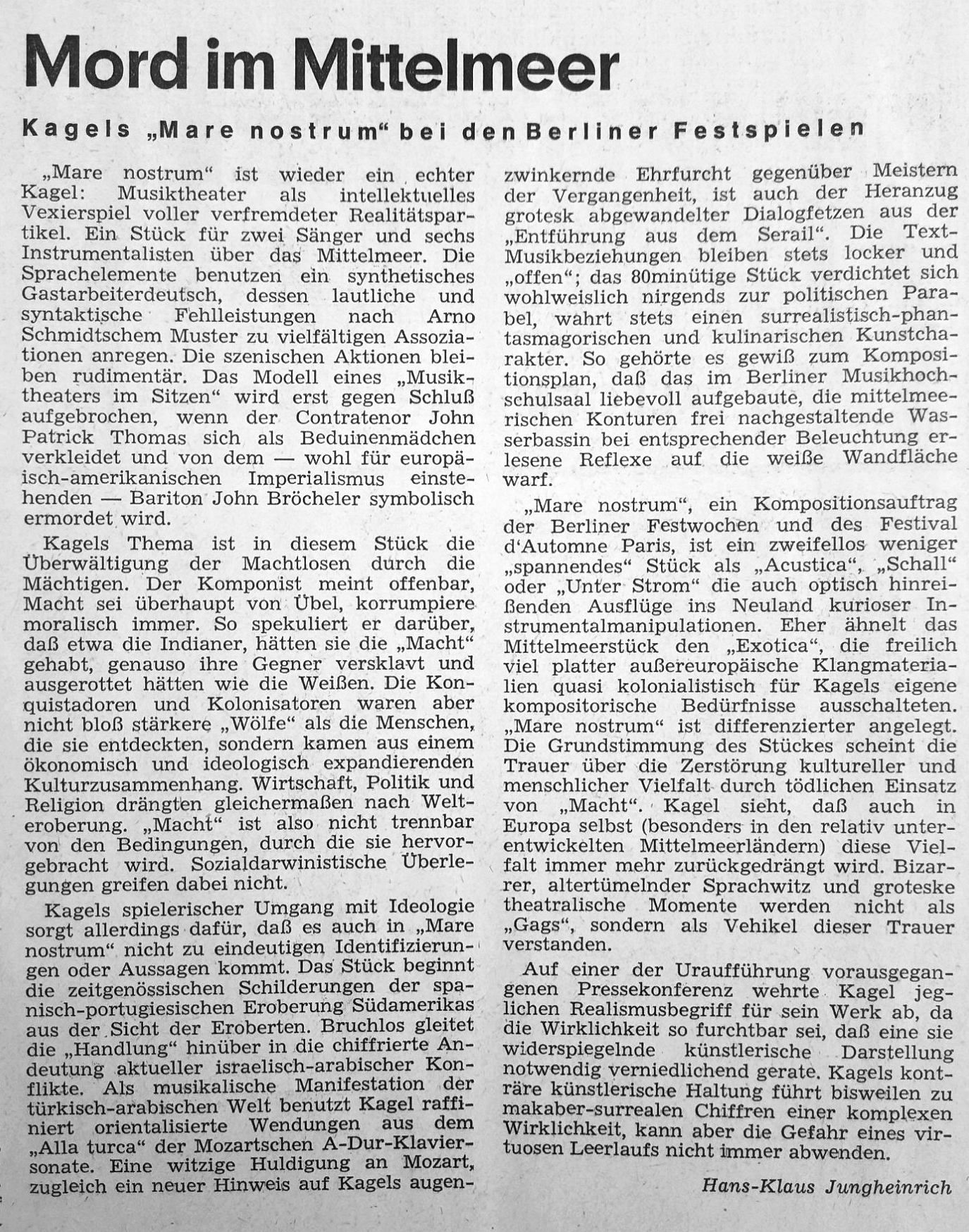
Vor 50 Jahren: Kagels „Mare nostrum“ bei den Berliner Festspielen
„Mare nostrum“, ein Kompositionsauftrag der Berliner Festwochen und des Festival d’Automne Paris, ist ein zweifellos weniger „spannendes“ Stück als „Acustica“, „Schall“ oder „Unter Strom“, die auch optisch hinreißenden Ausflüge ins Neuland kurioser Instrumentalmanipulationen. Eher ähnelt das Mittelmeerstück den „Exotica“, die freilich viel platter außereuropäische Klangmaterialien quasi kolonialistisch für Kagels eigene kompositorische Bedürfnisse ausschalteten. „Mare nostrum“ ist differenzierter angelegt. Die Grundstimmung des Stückes scheint die Trauer über die Zerstörung kultureller und menschlicher Vielfalt durch tödlichen Einsatz von „Macht“. Kagel sieht, daß auch in Europa selbst (besonders in den relativ unterentwickelten Mittelmeerländern) diese Vielfalt immer mehr zurückgedrängt wird. Bizarrer, altertümelnder Sprachwitz und groteske theatralische Momente werden nicht als „Gags“, sondern als Vehikel dieser Trauer verstanden.
Auf einer der Uraufführung vorausgegangenen Pressekonferenz wehrte Kagel jeglichen Realismusbegriff für sein Werk ab, da die Wirklichkeit so furchtbar sei, daß eine sie widerspiegelnde künstlerische Darstellung notwendig verniedlichend gerate. Kagels konträre künstlerische Haltung führt bisweilen zu makaber-surrealen Chiffren einer komplexen Wirklichkeit, kann aber die Gefahr eines virtuosen Leerlaufs nicht immer abwenden.
Hans-Klaus Jungheinrich, Neue Musikzeitung, XXIV. Jg., Nr. 5, Oktober 1975
- Share by mail
Share on